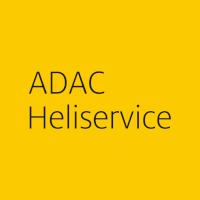Standort Bremen
Vom schwarzen Material sieht man allerdings nicht mehr viel, wenn die Flügelkästen aus dem britischen Partnerwerk Broughton angeliefert werden. Zum größten Teil sind sie unter dem Schutzlack gar nicht von den A330-Flügeln zu unterscheiden, die ebenfalls in Bremen mit Elektrik und Hydraulik, mit Vorflügeln, Klappen und Spoilern sowie Klima- und Enteisungsanlagen ausgerüstet werden, bevor sie per Airbus-Beluga nach Toulouse zur Endmontage gelangen.
Derzeit liegen in der großen Bremer Montagehalle allerdings nur LR-Flügel, „long range“ also, die Tragflächen für die A330, die sich auf dem internationalen Markt wie geschnitten Brot verkauft. In einer kleinen Halle nebenan sind indessen schon zwei A350-Flügel aufgebockt und erhalten hier ihren letzten Schliff. An den Flügelspitzen baumeln Pappschilder mit der Aufschrift „Finnair“. „Vorserie“, sagt lakonisch Christoph Zapf, der Chef des Ganzen, dessen komplizierte Dienstbezeichnung auf der Visitenkarte ganze zwei Zeilen einnimmt. Ausruhen vor dem großen Sturm also?
„Auf keinen Fall!“, protestiert Zapf energisch und zeigt dem Besucher stolz, was sich seit dem letzten Besuch der FLUG REVUE vor genau zehn Jahren am norddeutschen Airbus-Standort verändert hat. „Damals haben wir hier die Flügel der A330/A340-Familie ausgerüstet, doch die Produktion der letzteren wurde inzwischen eingestellt. Gleichzeitig wurde für uns klar, dass wir uns auch um die nächste Long-Range-Generation kümmern würden, was eine riesige He-rausforderung an alle Mitarbeiter stellt.“
Der Umgang mit dem neuen Material ist da noch der kleinste Anspruch, dem die Bremer genügen müssen. Vor allem wurde der komplette Ablauf der Installationen neu überdacht und optimiert. Vor wenigen Jahren noch wurde an fünf Stationen jeweils ein Flügelpaar komplettiert. Waren die jeweiligen Arbeiten abgeschlossen, musste zwischen den Stationen Platz geschaffen werden und alles rückte eine Etappe weiter. Vorn ein komplettes Shipset, wie die Paare auch genannt werden, raus, hinten zwei „Rohlinge“ rein. Die Fachkräfte zogen von Anfang bis Ende mit „ihrem“ Flügel mit.
„Die Rationalisierung der Arbeitsabläufe begann bereits weit vor der Anlieferung der ersten A350-Flügel“, berichtet Christoph Zapf, und man merkt ihm den Stolz auf das Geleistete an. Er aber wehrt ab: „Vielmehr bin ich stolz auf unsere Mitarbeiter, die von Anfang an den gesamten Veränderungsprozess mit gestaltet haben. Ohne sie wären wir heute erst halb so weit“, und dann beschreibt er die veränderte Technologie, wie sie schon jetzt bei den A330-Flügeln angewendet wird.
„Das wichtigste Prinzip lautet: Ändere niemals ein bewährtes System!“, sagt er. „Wir werden auch künftig an fünf Stationen arbeiten und immer im Wechsel ein A330- und ein A350-Shipset komplettieren.“ Das ist aber auch schon alles, was noch an die alten Abläufe erinnert.
Warten auf Belugas
Der komplette Ausrüstungsprozess beginnt mit der Anlieferung der Tragflächen, schon hier gibt es Unterschiede: Kann eine Beluga ein komplettes A330-Shipset an- und abtransportieren, so fasst der riesige Bauch des Transporters nur einen A350-Flügel. Das stellt große Anforderungen an die Transportplaner der Beluga-Flotte, denn man wird noch ein paar Jahre auf deren größere Nachfolger warten müssen. Ist dann das „rohe“ Shipset angeliefert, wird es in der Montagehalle eingetaktet, und es beginnt nun die Komplettierung. Im Zuge des Durchgangs werden an einem A330-Flügel rund 100 Großbauteile, etwa 250 Geräte, 600 Meter Hydraulik- und 24 Kilometer Elektroleitungen installiert; bei einem A350-Bauteil sind ähnliche Größenordnungen anzusetzen.
Bei unserem letzten Besuch benötigte man für all diese Arbeiten noch 15 Tage und 2500 Arbeitsstunden, heute nur noch die Hälfte! Wie war das möglich? „Wir haben beispielsweise bei Beibehaltung von fünf Stationen und sechs Lieferpunkten für alle Materialien den Ablauf dergestalt verändert, dass jetzt alle Arbeitstische, Vorratsregale und ähnliche bewegliche Anlaufpunkte für die Mitarbeiter niedriger als die Tragflächen sind. Heute müssen wir nicht mehr die ganze Halle räumen, wenn die Flügel zur nächsten Etappe vorrücken.
Am wichtigsten aber ist, dass die Kollegen nicht mehr mit jeder Fläche von Station zu Station ziehen, sondern sich auf ihrer jeweiligen Position mehr und mehr Erfahrung und Routine aneignen. Das geschieht derzeit nicht zuletzt dadurch, dass die Mitarbeiter jetzt schon von der kleinen in die große Halle und umgekehrt wechseln, wo sie einmal am A330-, einmal am A350-Flügel arbeiten – genauso, wie es später beim Serienhochlauf der A350 nur noch in der großen Halle sein wird.
Eine weitere wesentliche Neuerung ist eine begehbare Arbeitsbrücke, welche die Halle längs teilt. Knapp über den Flügeln sind hier Elektro-, Hydraulik- und Prüfstationen verteilt; zogen sich früher beispielsweise für Funktionstests der Klappen Hydraulikzuleitungen durch die Halle, genügt jetzt der kurze Anschluss zur Station über den Köpfen der Mitarbeiter.
Auch am Hallenboden gab es Veränderungen: „Wenn wir beispielsweise für Funktionstests die Klappen am A350-Flügel ausfahren, so würden diese auf dem Beton aufschlagen. An den letzten beiden Arbeitsstationen sorgen deshalb hydraulische Stempel dafür, dass die gesamte Fläche um 80 Zentimeter angehoben wird“, erklärt Christoph Zapf.
Inzwischen sind alle Kollegen mittels dieser Rationalisierung der Arbeit und dank des ständigen Trainings an den Vorserienflügeln bestens auf den Serienanlauf vorbereitet. Dabei haben sie noch weitreichende Pläne, denn in zwei Jahren soll alle fünf Tage ein komplettes Shipset ausgeliefert werden können, dreieinhalb Tage weniger als heute!
FLUG REVUE Ausgabe 04/2015