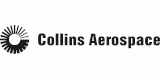Deshalb wundert es nicht, dass er sich der eigentlich als Reiseflugzeug konzipierten Bölkow Monsun aus der Sicht ihrer Kunstflugtauglichkeit nähert. Nach seiner aktiven Karriere blieb Wolfrum dem Kunstflug unter anderem als Nationaltrainer und Wertungsrichter verbunden. Nie wieder war ein deutsches Kunstflug-Nationalteam so erfolgreich wie zu seiner Zeit als Trainer. Im Zweiten Weltkrieg gehörte er mit 137 Abschüssen zu den besten Jagdfliegern. Wolfrum, Jahrgang 1923, verstarb 2010 im Alter von 87 Jahren in Schwabach. Hier nun sein Bericht über eines der besten deutschen Leichtflugzeuge der Nachkriegszeit, dessen Produktion 1972 trotz großer Nachfrage von MBB aus industriepolitischen Gründen eingestellt wurde.
Die Marktsituation 1969
Es ist kein Geheimnis, daß bis heute - 24 Jahre nach Kriegsende - der Bau von Sport- und Leichtflugzeugen in Deutschland immer noch nicht an die großen Erfolge der Vorkriegszeit anknüpfen konnte. Von einigen nicht gerade überzeugenden Mustern verschiedener kleiner Hersteller abgesehen, die in keinem Fall nennenswerte Stückzahlen erreichen konnten, waren es eigentlich nur die von Bölkow hergestellten Flugzeuge, die den deutschen Leichtflugzeugbau bis heute am Leben erhielten.
Neben dem bereits vor einiger Zeit ausgelaufenen Viersitzer BO 207 war es vor allem die Bölkow BO 208 Junior, die sich in Europa einen gewissen Marktanteil erkämpfte und sogar in die USA exportiert wird. Ursprünglich die Amateurkonstruktion eines in Amerika lebenden Schweden, die Malmö Flygindustri als MFI-9 Junior fertigt, hat sich der in Lizenz bei Bölkow gebaute Junior im Laufe der Jahre zu einem zuverlässigen und wirtschaftlichen Zweisitzer mit guten Flugeigenschaften und ansprechenden Leistungen gemausert. Bedingt durch seine Auslegung lässt sich dieser Typ jedoch nicht mehr wesentlich weiter entwickeln, so daß die Firma Messerschmitt-Bölkow gut daran tat, sich für ein Nachfolgemuster, die BO 209 Monsun, zu entscheiden.
Hermann Mylius entwickelt die MHK 101

Ausgangspunkt für die Monsun war wieder eine Amateurkonstruktion. Diesmal brauchte man jedoch den Konstrukteur nicht in Amerika zu suchen, man hatte ihn im eigenen Hause in Gestalt von Diplom-Ingenieur Hermann Mylius, der seit einigen Jahren den Leichtflugzeugbau bei Bölkow leitet. Bereits auf der Luftfahrtschau 1968 in Hannover erregte der als MHK 101 bezeichnete Prototyp durch seine Auslegung, seine gelungene Form sowie die solide und saubere Bauausführung Interesse. Auch ich war von der Maschine fasziniert. Beigetragen hat dazu ohne Zweifel auch die sehr geräumige und bequeme Kabine des Tiefdeckers mit ausgezeichneten Sichtverhältnissen, die in nichts mehr an den „maßgeschneiderten" Junior erinnerte. Das einzige Junior-Relikt im Cockpit war der Zentralknüppel, der jedoch in der Serie durch normale Steuerknüppel vor jedem der beiden Sitze ersetzt werden soll.
Erste Bekanntschaft mit dem Prototyp

Ich nahm in Hannover sofort die Gelegenheit wahr, die MHK 101, zu jener Zeit mit einem 115 PS-Lycoming-Motor und fester Luftschraube ausgerüstet, zu fliegen. Der Start erfolgte völlig normal; ungewohnt und etwas kompliziert war lediglich das manuelle Einziehen des Bugrades. Die Mechanik soll in der Serie von einem elektrischen Einziehmechanismus abgelöst werden. Auf die Einziehbarkeit des Hauptfahrwerks wurde aus Preis- und Gewichtsgründen zunächst verzichtet, zumal aerodynamisch in erster Linie ein Verschwinden des Bugrades Vorteile versprach, während der Luftwiderstand des Hauptfahrwerkes bei Verwendung guter Radverkleidungen nach Ansicht des Konstrukteurs nicht allzu sehr ins Gewicht fällt.
In der Praxis konnte ich tatsächlich feststellen, daß die Steigleistung und noch mehr die Horizontalgeschwindigkeit der Maschine klar über dem Durchschnitt vergleichbarer Muster lagen. Besonders gespannt war ich auf die Flugeigenschaften, da ja vom Konstrukteur von Anfang an eine gute Kunstflugtauglichkeit angestrebt wurde. Ich begann mit Abkippen, dann Trudeln, beides ergab keine Probleme, mit der einen Einschränkung vielleicht, daß die Maschine - ähnlich wie schon die Bölkow Junior - nach 1,5 Trudelumdrehungen etwas schnell wird. Gesteuerte Rollen sind bekanntlich mit dem Junior nicht einwandfrei fliegbar, das heißt, es kommt stets mehr oder weniger eine Faßrolle heraus; ganz anders die MHK 101, Rollen nach links und rechts ließen sich exakt um den Punkt drehen - selbstverständlich machte von der Rückenlage an der Vergasermotor dabei nicht mehr mit. Auch Turns ließen sich recht ordentlich fliegen, eine Verbesserung der Steuerbarkeit erschien mir jedoch durch ein größeres Seitenruder möglich. Schließlich probierte ich Loopings - normalerweise die einfachsten Figuren - und wurde unangenehm überrascht. Kurz vor Erreichung des oberen Scheitelpunktes vollführte die Maschine unmotiviert und plötzlich gerissene Rollen. Es gelang mir erst nach mehreren Versuchen, einen Looping recht und schlecht zu vollenden, als ich bei Erreichung dieses kritischen Punktes - entgegen jedem Gefühl - den Knüppel brutal an den Bauch zog und damit diese Stelle gewissermaßen überbrückte. Verständlich, daß ich etwas enttäuscht landete; Dipl. Ing. Mylius tröstete mich jedoch und versprach mir, diese Unart, die nach seiner Ansicht auf die Profilierung der Flächennase am Rumpfanschluß zurückzuführen sei, zu beseitigen.
Das erste Serienflugzeug im Test

Die zweite Bekanntschaft mit dem Flugzeug, das inzwischen von der Firma Messerschmitt-Bölkow voll adoptiert worden war und die Typenbezeichnung BO 209 Monsun erhalten hatte, fand knapp ein Jahr später statt, als kürzlich das Muster offiziell vorgestellt wurde. Für die jetzt anlaufende Serie sind wahlweise drei Lycoming-Triebwerke vorgesehen: O-235 mit 115 PS, O-320 mit 150 PS und der Einspritzmotor IO-320 mit 160 PS; die 150- und 160-PS-Versionen können sowohl mit fester als auch mit Verstellschraube geliefert werden. In den Prototyp war inzwischen der 150 PS-Motor mit festem Metallpropeller eingebaut worden.
Schon beim Start und noch mehr beim Steigflug machen sich die zusätzlichen 35 PS sehr positiv bemerkbar; das Flugzeug hebt nach knapp 200 m sicher ab und steigt anschließend (einsitzig) mit 6 bis 7 m/s. In gleichem Maße hat die Reisegeschwindigkeit gewonnen, 250 km/h werden mühelos erreicht. Nun der Looping-Test: aus Reisegeschwindigkeit ziehe ich die Maschine hoch und vollende ohne die geringste Stall-Erscheinung einen sauberen Looping - selbstverständlich ohne jeglichen Höhenverlust. Der Konstrukteur hatte also Wort gehalten! Bei allen anderen Kunstflugfiguren wurde der gute Eindruck, den ich bereits beim ersten Flug ein Jahr vorher erhalten hatte; voll bestätigt. Leider hatte das Flugzeug noch nicht das für die Serie vorgesehene, zirka zehn Prozent größere Seitenruder erhalten, so dass Turns immer noch nicht mit letzter Vollendung geflogen werden konnten. Gerissene und gestoßene Rollen sind kein Problem, sie lassen sich in gewohnter Weise einleiten und sauber stoppen. Festigkeitsbedenken sind unangebracht, soweit diese Figuren mit Geschwindigkeiten unter 200 km/h geflogen werden, da das Flugzeug die für Vollkunstflug vorgeschriebene Belastbarkeit von +6 g/-3 g besitzt.
Auch Rückenfiguren probierte ich - mit stehendem Motor natürlich - und hatte den Eindruck, daß Eigenschaften und Leistungen auch bei negativen Anstellwinkeln gut sind. Es besteht für mich kein Zweifel, dass das Flugzeug mit dem rückenflugtauglichen 160 PS-Einspritzmotor und Constant-Speed-Propeller eine sehr gute Kunstflugmaschine sein wird, mit der man nicht nur einwandfrei Kunstflug schulen und saubere Prüfungsprogramme fliegen kann, sondern die auch für höhere Kunstflugaufgaben verwendbar ist.
Man verzeihe einem begeisterten Kunstflieger, wenn ich bisher zu erwähnen vergaß, dass das Flugzeug außer Kunstflug auch noch etwas anderes kann. Die gleiche Maschine (mit dem gleichen festen Propeller) erlebte ich auch als Schleppmaschine mit einem Phoebus am Seil. Mein Eindruck: Startstrecke etwa so lang wie mit einer 150 PS Super Cub, Steigleistung besser! Auch für diesen Zweck dürfte die 160 PS Maschine mit Verstelluftschraube noch eine weitere Leistungssteigerung bringen, so daß die Monsun auch ein erstklassiges Schleppflugzeug werden wird.
Höchst attraktiv für Privatpiloten

Was dieses Flugzeug jedoch für die Masse der Privatpiloten attraktiv machen wird, sind die ausgezeichneten Leistungen und Eigenschaften im Reiseflug. Ich erwähnte bereits die großzügigen Kabinenmaße, die Bequemlichkeit der beiden nebeneinander liegenden Sitze und die exzellenten Sichtverhältnisse durch die Vollsicht-Schiebehaube. Auch die Bequemlichkeit des Einstiegs lässt nichts zu wünschen übrig. Der hinter den Sitzen liegende Gepäckraum, der bei ganz zurückgeschobener Kabinenhaube leicht zu beladen und auch im Flug erreichbar ist, besitzt nicht nur eine ausreichende Größe, sondern verträgt dank der guten Zuladung mit 50 bis 75 kg auch genügend Gewicht. Das Instrumentenbrett ist groß, übersichtlich und bietet auch in der Einbautiefe genügend Raum für alle gängigen Funkgeräte bis zur IFR-Ausrüstung. Besonderer Wert wird bei den Serienflugzeugen auf gute Schallisolierung gelegt; durch eine neuartige Dämpfung des Auspuffgeräusches soll darüber hinaus auch der außen wahrnehmbare Lärm erheblich reduziert werden.
In seinen Reiseleistungen kommt das Flugzeug an die ausgezeichneten Werte einer Falco beziehungsweise Super Falco heran und auch in ihrem Stabilitätsverhalten entspricht die Monsun den Anforderungen, die an ein gutes Reiseflugzeug zu stellen sind. Ein besonderer Clou mit praktischem Wert ist die Möglichkeit, die beiden Tragflächen für den Straßentransport oder die Unterstellung in einer größeren Garage an den Rumpf anzuklappen. Diese Verwandlung kann innerhalb von 15 Minuten bewerkstelligt werden. Mittels eines Autoadapters, der am Rumpfheck befestigt wird, kann die Maschine an die Kupplung eines PKW angehängt werden, das Bugrad wird dazu eingezogen. Nach Auskunft des Herstellers wurde auf diese Weise der Prototyp bereits über mehrere tausend Straßenkilometer ohne irgendeine Panne transportiert.
Robuste Konstruktion für hohe Lebensdauer

Die Monsun ist in einer einfachen und robusten Ganzmetallkonstruktion ausgeführt. Das Rumpfheck einschließlich Leitwerk mit Pendelruder entspricht weitgehend dem Junior, von dem auch das Hauptfahrwerk mit seinen bewährten Federstahlstreben stammt. Alles andere ist neu. Einen hervorragenden Eindruck macht der trapezförmige Tragflügel durch seine saubere Verarbeitung und glatte Oberfläche. Die großen Wölbklappen mit guter Auftriebs- und bei vollem Ausschlag ebenso guter Bremswirkung werden wie beim Junior elektrisch betätigt; sie können sogar um drei Grad nach oben ausgefahren werden zur Verbesserung der Rückenflugleistung. Die beiden Kraftstofftanks in den Tragflächen fassen je 70 Liter und erlauben eine mühelose Betankung.
Zwischen beiden Sitzen liegt der Bremshebel mit Park-Feststellung; eine getrennte Betätigung der beiden Scheibenbremsen am Hauptfahrwerk ist nicht möglich, was ich jedoch der kleinen und sehr rollwendigen Monsun nicht als Nachteil ankreiden möchte, zumal das Bugrad in üblicher Weise mit den Pedalen gekoppelt ist und durch seinen großen Einschlag einen engen Wendekreis zuläßt. Alles in allem erscheint das Fahrwerk als eine gute Lösung, da es auch über einen guten Federungskomfort verfügt.
Mit drei Schnellverschlüssen an jeder Seite wird die Motorhaube geöffnet. Auch die gute Zugänglichkeit zu den übrigen Wartungsstellen zeigt, daß die Maschine bis ins Detail wohl durchdacht ist.
Preisgestaltung
Wenn der von Messerschmitt-Bölkow angekündigte Preis zwischen DM 39 000,- und DM 50 000, je nach Motor und Ausstattung gehalten werden kann, besteht für mich kein Zweifel, dass dieses Flugzeug ein Verkaufsschlager werden wird, da es dem Wunschbild eines Sportfliegers in vieler Hinsicht sehr nahe kommt. Eine Maschine mit so guten Reiseleistungen bei gleichzeitig hervorragender Schlepptauglichkeit und einer sehr guten Eignung für den Kunstflug hat bisher noch gefehlt.
Walter Wolfrum (Juli 1969)