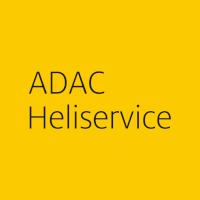Saab J 21R
Am 10. März 1947 schrieb Testpilot Ake Sundén ein wichtiges Kapitel in der noch jungen Geschichte der Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Saab). Vom Werksflugplatz in Linköping startete er zum Jungfernflug mit dem ersten strahlgetriebenen Flugzeug aus schwedischer Entwicklung. Das mit einem de Havilland Goblin ausgerüstete Jagdflugzeug J 21R war in weniger als eineinhalb Jahren entstanden.
Die flotte Realisierung des Projekts unter Leitung von Ragnar Härdmark hatte allerdings einen einfachen Grund: Der neue Jäger basierte auf der propellergetriebenen J 21A, die seit 1945 in der Produktion stand. Die von Frid Wännström in nur zehn Tagen skizzierte Konstruktion mit Heckmotor und Doppelleitwerk eignete sich besonders für die Umrüstung auf die zukunftsträchtige Antriebsart.
Zunächst hatte man daran gedacht, die neue J-21-Version mit Strahlturbinen aus einheimischer Entwicklung auszurüsten. Sowohl Svenska Flygmotor als auch STAL Laval arbeiteten an entsprechenden Entwürfen. Schnell wurde jedoch klar, dass diese noch längst nicht serienreif waren. So beschloss man die Lizenzfertigung des Goblin und wies Saab im November 1945 an, dieses Aggregat mit möglichst geringem Aufwand in der J 21 unterzubringen. Erste Untersuchungen der Saab-Ingenieure. gingen davon aus, dass man etwa 80 Prozent des Ursprungsmusters übernehmen könnte.
Im Laufe der Detailkonstruktion stellte sich jedoch schnell heraus, dass wesentlich mehr Modifikationen notwendig waren. Vier noch nicht komplettierte J 21A-1 (Werknummern 21116, 21119, 21121 und 21123) wurden von der Montagelinie genommen und dienten als Basis für die Prototypen der J 21R (R = Reaktionsantrieb). Da das Goblin-Triebwerk mit seinem Axialverdichter eine deutlich größere Frontfläche als der DB-605B-Motor aufwies, musste der Rumpf hinter dem Brandschott völlig neu gestaltet werden. Der Übergangsbereich wurde dabei geschickt für die seitlichen Lufteinläufe genutzt.
Um dem gestiegenen Treibstoffverbrauch wenigstens einigermaßen gerecht zu werden, wurde der Behälter hinter dem Cockpit vergrößert und zusätzliche Tanks im inneren Flügelbereich untergebracht, wo sich zuvor die Kühler befunden hatten. Außerdem musste eine Heizung für das Ölsystem des Goblin eingebaut werden, das ansonsten den arktischen Temperaturen in Schweden nicht gewachsen gewesen wäre.
Strukturelle Änderungen betrafen insbesondere die Leitwerksträger, die vorbeugend gegen mögliche Schwingungsprobleme verstärkt wurden. Auch musste man das Höhenleitwerk aus dem heißen Abgasstrahl heraus nach oben verlegen. Für die höheren Geschwindigkeiten wurden zudem einige Wartungsklappen stärker ausgeführt. Das Hauptfahrwerk wurde um 20 Zentimeter nach vorn verlegt.
Aerodynamische Verfeinerungen beschränkten sich auf eine abgerundete Windschutzscheibe und eine widerstandsärmere Flügelvorderkante. Hinzu kamen kleine Bremsklappen auf Ober- und Unterseite und Änderungen am Klappensystem. Das Cockpit wurde ebenfalls den neuen Erfordernissen angepasst, zum Beispiel mit einer Machanzeige, besserem Visier sowie überarbeiteten Sauerstoff- und Funkgeräten.
Erprobung der J 21R

Die Erprobung der J 21R verlief nicht ohne schwere Zwischenfälle. Zwei Maschinen gingen verloren: Eine explodierte in der Luft, als sich das Anschlussstück einer Treibstoffleitung löste, die andere wurde durch ein wegfliegendes Turbinenteil des Goblin steuerlos und stürzte am 22. September 1947 nahe Norrköping ab. Besonders problematisch war die Tatsache, dass sich die J 21R mit ihrer auf 800 km/h gesteigerten Höchstgeschwindigkeit gefährlich der kritischen Machzahl des Flügelprofils näherte. Bei Vollschub genügte schon ein geringer Bahnneigungswinkel, um ein beängstigendes Schütteln der Maschine auszulösen.
Die Eignung der J 21R als Jäger wurde von den Piloten entsprechend zwiespältig bewertet. Wie bei der J 21A war für die Steuerung einiger Kraftaufwand notwendig, und besonders die Rollraten waren gering. In Höhen über 6000 Meter ließ die Steigleistung sehr zu wünschen übrig. Andererseits besaß die J 21R ein sehr gutmütiges Überziehverhalten, war kaum zu trudeln, einfach zu starten und zu landen und bot eine sehr stabile Plattform beim Einsatz der Bordwaffen. Das Cockpit war geräumig, und der raketengetriebene Katapultsitz gab ein Gefühl großer Sicherheit.
Die Produktion der J 21R lief 1949 an. Da die Flygvapnet zwischenzeitlich in Großbritannien als erster Exportkunde eine große Anzahl Vampires geordert hatte, wurde der ursprünglich auf 120 Flugzeuge lautende Auftrag halbiert. 60 Flugzeuge reichten nur noch für die Ausstattung eines Geschwaders aus, und so rüstete Anfang 1950 das F10 in Ängelholm auf die J 21R um. Die ersten 30 Flugzeuge (J 21RA) hatten noch importierte Goblin II mit 13,2 Kilonewton Schub, der Rest erhielt dann leistungsstärkere Goblin III (14,7 kN) aus der Lizenzproduktion von Svenska Flygmotor in Trollhättan (einheimische Bezeichnung: RM 1A). Die letzte J 21R lieferte Saab im Januar 1951 aus.
Die Piloten des Geschwaders F10 konnten nur wenige Erfahrungen mit der J 21R in der Jagdrolle sammeln. Wegen der bei realistischen Einsatzbedingungen auf etwa 40 Minuten beschränkten Flugdauer waren Operationen in größeren Formationen unmöglich. Man setzte vielmehr auf schnelle Angriffe von vorn, ohne sich auf lange Kämpfe einzulassen. Schon von Sommer 1950 an wurden einige J 21R vom F10 an das Geschwader F7 in Satenäs überstellt, wo sie die A 21A ablösten. Nun ebenfalls mit einem „A“ für Angriff bezeichnet, wurden sie für den Erdkampf eingesetzt.
Für diese neue Rolle waren die Flugzeuge deutlich besser geeignet, und die Flygvapnet ging daran, ihre Bewaffnung zu ergänzen. Zu den im Rumpfbug und in den Flügeln eingebauten fünf Kanonen/MGs kam ein kreisförmiger Behälter unter dem Rumpf mit nicht weniger als acht 13-mm-MGs. Die A 21R war im Gegensatz zur A 21A-3 nicht für den Transport von Bomben vorgesehen, aber es wurden intensive Versuche mit ungelenkten Luft-Boden-Raketen durchgeführt. Unter anderem wurden Konfigurationen mit zehn l0-cm- und zwei 21-cm-Raketen getestet. Als Standard entschied man sich aber letztlich für acht 14,5-cm-Raketen von Bofors, die von einem Träger unter dem Mittelflügel abgefeuert wurden.
Die A 21R diente auch als Versuchsträger für die sogenannte Attackrobot 301, eine 800 km/h schnelle Luft-Boden-Lenkwaffe mit Deltaflügeln von 2,8 Metern Spannweite. Dieses Projekt wurde jedoch 1950 wegen Stabilitätsproblemen eingestellt.
A 21R bis Mitte 1954. In dieser Zeit verfeinerte die Flygvapnet die Angriffstaktiken, wobei schon großer Wert auf den Tiefflug gelegt wurde, um der Entdeckung durch Radar zu entgehen. In Zusammenarbeit mit Heer und Marine wurden Planungsteams aufgestellt und neue Führungsverfahren erprobt. Im täglichen Einsatz erwies sich die A 21R als recht zuverlässig. Probleme bereitete manchmal das hydraulisch betätigte Fahrwerk, doch Bauchlandungen führten selten zu größeren Beschädigungen. Schwieriger war da schon die Landung mit nur einem geleerten Tank an der Flächenspitze, wenn Treibstoffventile versagt hatten.
Nachdem die A 21R auch in der Angriffsrolle überholt war, wurden die meisten Maschinen rasch verschrottet. Zehn Flugzeuge gingen aber noch an das Geschwader F17 in Kallinge. Dort dienten sie zur Umgewöhnung von Bomberpiloten auf den Jetantrieb. Als die Umstellung vom zweimotorigen B 18B auf die Lansen abgeschlossen war, wurden aber auch diese 1956 außer Dienst gestellt. Heute existiert keine einzige J 21R mehr. Allerdings ist im Flygvapenmuseum in Malmen bei Linköping eine Jetversion zu sehen. Diese entstand jedoch als Umbau der J 21A-3 mit der Seriennummer 21286. Der Luftfahrthistorische Verein Östergötlands Flyghistoriska Sällskap leistete dabei unter Leitung von Kurt Zetterholm von 1988 bis 1998 unzählige Arbeitsstunden.
J 21A: Saabs erster Jäger

Nachdem sich die Flygvapnet zunächst mit Importen und der in Rekordzeit selbst entwickelten J 22 beholfen hatte, erhielt Saab 1941 grünes Licht für den Bau ihrer J 21. Schon 1939 hatte Saab der Flygvapnet das von Frid Wännström in nur zehn Tagen skizzierte Modell L13 angeboten, doch erst mit der Verfügbarkeit des flüssigkeitsgekühlten Daimler-Benz DB 601 zeigten sich die Beschaffungsbehörden von der Realisierbarkeit eines Pushers mit Doppelleitwerk überzeugt. Im April 1941 beauftragten sie das Unternehmen mit der Entwicklung der J 21, die schließlich am 30. Juli 1943 mit Claes Smith am Steuer zu ihrem Erstflug startete. Dabei rollte die Maschine durch einen Zaun und fast in einen Graben, bevor sie in die Luft kam. Bei der Landung knickte dann das angebrochene Fahrwerk ein, was zu einigen Beschädigungen führte.
Flugerprobung und Serienvorbereitung zogen sich deutlich länger hin als zunächst gedacht, so dass die ersten J 21 erst im Sommer 1945 ausgeliefert wurden. Drei Jagdgeschwader – F9, F12 und F15 – waren bis 1953 mit der Maschine ausgerüstet, die angesichts des Siegeszugs des Strahlantriebs von Anfang an veraltet war. Deshalb wurde die J 21 auch für den Einsatz gegen Bodenziele modifiziert und dann als A 21 bezeichnet. Diese Version war ab 1948 verfügbar und wurde bei den Geschwadern F6 und F7 verwendet. Sie konnte Raketen und bis zu 500 Kilogramm schwere Bomben mitführen. Die letzten kolbenmotorgetriebenen Saab J A21 gingen Anfang 1949 an die Flygvapnet. Insgesamt fertigte das Unternehmen in Trollhättan und Linköping 302 Flugzeuge.
Trotz ihrer ungewöhnlichen aerodynamischen Auslegung hatte die Maschine eine recht konventionelle Metallstruktur. Die Kühler für den DB 605 hatte man in den Innenflügeln untergebracht. Sie waren allerdings recht knapp dimensioniert, so dass die Piloten sehr darauf achten mussten, eine Überhitzung zu vermeiden. Für den sicheren Ausstieg über den Propeller und das Leitwerk hinweg entwickelte Saab eigens einen raketengetriebenen Katapultsitz.
Technische Daten
Saab J 21R
Hersteller: Saab, Trollhättan und Linköping
Verwendung: Jäger, Jagdbomber und Trainer
Besatzung: 1
Antrieb: 1 x de Havilland Goblin II oder III
Startschub: 13,2 oder 14,7 kN
Länge: 10,56 m
Höhe: 2,90 m
Spannweite: 11,37 m
Flügelfläche: 22,3 m2
Leermasse: 3112 kg
Kraftstoff: 934 l plus 800 l in Zusatztanks an den Flügelspitzen
normale Startmasse: 5033 kg
Höchstgeschwindigkeit: 800 km/h
Marschgeschwindigkeit: 700 km/h
Steigrate: 17 m/s
Dienstgipfelhöhe: 12 500 m
Reichweite: 900 km
normale Flugdauer: ca. 40 min
Lastvielfaches: 6,3 g
Bewaffnung: 1 x 20-mm-Kanone, 4 x 13,2-mm-MG, extern 8 x 13,2-mm-MG sowie 10 Raketen
Klassiker der Luftfahrt Ausgabe 03/2012