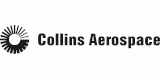René Fourniers exzellente Konstruktionen
Mit der RF-7 präsentiert der Konstrukteur René Fournier eine Neukonstruktion, die schon auf den ersten Blick seine Handschrift erkennen läßt. Seine Erfolgstypen RF-3, RF-4 D und RF-5 sind in den Fliegerkreisen der ganzen Welt bekannt. Berühmtheit erwarben sie durch spektakuläre Flüge wie die Atlantiküberquerungen der RF-4 D, aber dadurch allein läßt sich kein Flieger beeinflussen, wenn er ein Flugzeug kaufen will.
Die Robustheit der soliden Flugzeuge mit ihren in aller Welt bekannten VW-Motoren haben jedoch in kurzer Zeit sowohl Individualisten als Fliegergruppen davon überzeugt, daß der gute Ruf ehrlich erworben ist. Bei den oben genannten Typen, die bereits in mehreren hundert Exemplaren die Werkshalle verlassen haben, handelt es sich durchweg um Flugzeuge, die zunächst als Leichtflugzeuge entwickelt waren. Ohne Doppelzündung des Triebwerks wäre jedoch eine Zulassung als Motorflugzeug in Deutschland und auch in den meisten anderen Ländern (z. B. USA) nicht möglich gewesen. Damit wäre eine Einführung der gelungenen Konstruktionen in den meisten interessanten Absatzgebieten unmöglich geworden, besonders in Deutschland. Aber gerade hier erfolgte der große Start der RF-4 D und der RF-5 unter dem Begriff Motorsegler, da in diesem Falle Doppelzündung nicht erforderlich ist.
Es erwies sich wieder einmal mehr, wie groß die Auswirkungen eines Papiers sein können – in diesem Falle die deutschen Bestimmungen bezüglich der Zulassung von Leichtflugzeugen als Motorsegler –, wenn die geforderten Bedingungen erfüllt sind. In erster Linie handelt es sich dabei um die Erfüllung bestimmter Leistungen und die Möglichkeit einer leichten Handhabung durch Segelflugpiloten. Alle diese Bedingungen wurden auf Anhieb erfüllt, wenn auch teilweise nur knapp an der Grenze der Forderungen des Papiers. Insofern darf man also von positiven Auswirkungen der Bestimmungen über Motorsegler sprechen, die sonst in Fliegerkreisen durchaus umstritten sind. Sie haben uns die Einführung von sehr modernem, leistungsfähigem Fluggerät beschert, das endlich auch denen die Entfaltung ihrer fliegerischen Ambitionen ermöglicht, die nur über bescheidene finanzielle Mittel verfügen.
Wie schon bei den Testberichten der RF-4 D und RF-5 gesagt wurde, liegt die Betonung bei der Deutung des Begriffes Motorsegler bei diesen Typen auf dem Wort „Motor", und es ist kein Geheimnis, daß diese Flugzeuge kaum als Segler eingesetzt werden. Die Firma Sportavia-Pützer – der Hersteller – hat bewußt diese Marktlücke dicht an der Grenze zwischen Motorsegler und Leichtflugzeug ausgenutzt und hat, wie zu erwarten war, einen sehr großen Abnehmerkreis damit angesprochen. Die großen Verkaufsziffern sind dafür eindeutiger Beweis.
Entwicklung in Richtung Motorflugzeug

Mit der RF-7 wurde nun ein Flugzeug geboren, das in der Handhabung durchaus den Bedingungen der Kategorie Motorsegler entspricht, das aber in der Schwebeleistung bereits jenseits der Grenze liegt und daher also als Leichtmotorflugzeug gilt. Auf der Dahlemer Binz hatte man früh genug und mit Energie die Entwicklung eines Motors mit Doppelzündung eingeleitet, der eine Weiterentwicklung des bewährten Sportavia-Limbach SL 1700 E der RF-5 darstellt. Er wird bei der Firma Limbach-Sassenbach produziert und arbeitet mit Doppelmagnet-Zündung.
Es ist zu erwarten, daß die Entwicklung noch eine lageunempfindliche Ölversorgung und einen Rückenflugvergaser bringt, da die Maschine ausgezeichnete Kunstflugeigenschaften zeigt und auch festigkeitsmäßig voll für Kunstflug ausgelegt ist. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß eines Tages eine Einspritzanlage folgen wird. Nach der Luftfahrtausstellung in Hannover soll die Flugerprobung mit Hochdruck in Istres durchgezogen werden, so daß die Musterzulassung und der Beginn der Serienproduktion noch gegen Ende 1970 zu erwarten sind. Wenn man bedenkt, daß der Prototyp dieser kleinen Motormaschine erst Ende Februar 1970 seinen Erstflug hatte, so ist es immerhin beachtlich, daß das ganze Programm bis zur Musterzulassung und Serienproduktion in etwas über einem halben Jahr über die Bühne gehen wird. Daß die Entwicklung des Triebwerks SL 1700 D im gleichen Zeitraum abgeschlossen wird, ist kaum zu bezweifeln, denn der Motor gab bis jetzt keinen Anlaß zur Beanstandung und macht einen guten Eindruck.
Die Entschlußfreudigkeit dieser kleinen Firma sollte besonders in Deutschland Schule machen, denn es hat sich wieder einmal gezeigt, daß durchaus Marktlücken vorhanden sind. Es müssen wohl die vorhandenen technischen Mittel und die Erfahrung ausreichen, wenn aufgrund von Marktanalysen eine Lücke auf dem Markt erschlossen wird, die ausgenützt werden soll. Aber daran fehlt es ja meistens bei uns nicht. Die Entwicklung der RF-4 D mit ihrem Erfolg knapp diesseits der Grenze, gerade noch als Motorsegler, und die folgerichtige Weiterentwicklung der RF-7 in Richtung Mo-torflugzeug knapp jenseits dieser Grenze, ist ein glänzender Beweis dafür, wie vorhandene Kapazitäten des Know-how und der rationellen Fertigung ausgenutzt werden können. Ohne Entschlußkraft und ein gewisses unternehmerisches Risiko geht das allerdings nicht, aber ich glaube, das Wagnis einer Prophezeiung, daß die RF-7 einen guten Markt haben wird, ist nicht allzu groß.
Leider war das winterliche Wetter Ende April bei meinem Besuch bei Sportavia-Pützer nicht dazu angetan, reine Freude zu bereiten, aber die Dahlemer Binz war schon schneefrei, und der rassige, kleine Vogel entschädigte mich voll. Der Prototyp hatte erst einige Flugstunden hinter sich und machte in der blau-weißroten Kunstflugbemalung einen glänzenden Eindruck. Die Maschine verfügt im Vergleich zur RF-4 D über einen bulligen Motor mit 65 PS. Die Spannweite des durchgehenden Flügels wurde von 11,30 m auf 9,40 m reduziert, jedoch sind Rumpf und Leitwerk voll von der RF-4D übernommen worden. Beim Fahrwerk, das schon in der RF-4 D als besonders robust gelten kann, wurde aber ein Schritt weitergegangen. Die RF-7 besitzt nun ein ÖI-Gasfeder-Einbeinfahrwerk mit einem Federweg von 120 mm mit der gleichen bewährten Radgröße, und wenn auf der Dahlemer Binz, dem „berühmten" Fahrwerktestgelände, diese neue Konstruktion kaum noch Wünsche offen läßt, dann kann ich mir kein Gelände mehr vorstellen, das da noch Sorge bereiten soll.
Ein Testflug, der Spaß macht

Nun zu meinem Testflug: Vorbei an Schneewällen rollte ich vom Werkgelände über die Straße auf den Platz. Es war schon beim Rollen zu merken, daß hier ein stärkerer Motor brummt. Er zog die elegante Maschine mühelos durch alle aufgeweichten, wassergefüllten Querrillen und Schlammlöcher, auch aus dem Stand. Ich war mit dem ausgezeichneten fünfteiligen Gurtzeug mit Zentralschloß angeschnallt und fühlte mich in der mir von der RF-4 D wohlbekannten Kabine wie zu Hause. Die Hebel für Gas, Störklappen und Fahrwerk sind unverändert. Lediglich die Zugknöpfe für Luftklappe, Belüftung, Heizung und Anlasser liegen etwas anders und sind besser zusammengefaßt. Der Handzug der Bremse hat seinen alten Platz, zeigt sich aber wirksamer. Neu ist die einfache Tankschaltung mit den zwei Stellungen für die unabhängigen Flügeltanks mit je 25 Liter. Neu ist das unter dem Hauptinstrumentenbrett heruntergezogene Brett für die Triebwerküberwachung. Es enthält eine Reihe Sicherungen, elektrische Kraftstoffanzeige, Ampéremeter, Schmierstoffdruck- und Temperaturanzeige, einen Beschleunigungsmesser, verschiedene elektrische Schalter und komischerweise dazwischen eine Libelle. Sicher wird das in der Serie noch besser geordnet.
Beim Abbremsen mit 1800 U/min zeigte der Drehzahlmesser beim Schalten über die Magnete nur einen Abfall von knapp 50 U/min. Ich war bereit zum Start: Die RF-7 beschleunigte trotz des aufgeweichten Bodens durch lange Schlammspuren befriedigend, und das neue Federbein schluckte absolut alle Unebenheiten in einer Manier, die Beifall erheischt. Die Ruderwirkung ist schon nach dem Anrollen gut, und bei 85 km/h nahm ich den Vogel nach einer Rollstrecke von etwa 200 m vom Boden. Einerseits herrschte ein Gegenwind von etwa 10-15 km/h; andererseits ist ein schlechterer Boden für den Start kaum denkbar, so daß der Wert als gut zu bezeichnen ist.
Gasspitze weg, Anzeige 110 km/h, leicht ging das Fahrwerk rein. Mit 2900 U/min stieg ich, gut getrimmt, konstant bei einer Anzeige von über 3 m/sec und 100 km/h. Der Motor hat einen besonders kernigen, angenehmen Ton – wie ein Porsche. Ich mußte einigen erheblich umfang-reichen Schneeschauern ausweichen und war schon im Steigflug einige Male fast von finsteren Schauerwänden umzingelt. Die Heizung war voll aufgedreht, dürfte aber in ihrer Wirkung besser sein. Mit einer Steigrate von 2,5 m/sec erreichte ich schließlich 1500 m über Platz. Mit Stoppuhr und Höhenmesser errechnete ich allerdings eine etwas bessere Steiggeschwindigkeit, als das Variometer anzeigte. Das Ergebnis war in einer Höhe bis 500 m über Platz ein Wert von knapp 4 m/sec. Der beste Wert der errechneten Leistung liegt 5 m/sec, und es ist schon möglich, daß er erreichbar wird, wenn die für den Serienbau vorgesehene Verstellschraube zur Verfügung steht. Das Propellerwerk Hoffmann hat einen solchen Verstellpropeller für Triebwerke bis 90 PS bei 3600 U/min entwickelt, der dann endlich allen kleinen Flugzeugen mit Motoren unter 100 PS zu besseren Leistungen verhilft. Die RF-7 wird dann wohl die angegebenen Werte für Reisegeschwindigkeiten, Steigleistungen und Startstrecken erreichen.
Es ist einmal mehr festzustellen, daß auch auf dem Gebiet des Propellerbaus der Motorsegler eine Entwicklung eingeleitet hat, die sonst kaum erwartet werden konnte. Nun profitieren auch Motormaschinen davon, und der Serienbau von Verstellschrauben dieser Größe wird rentabler. Eigentlich ist auch nicht einzusehen, daß ausgerechnet Flugzeuge mit kleinen Motoren nicht über ein „stufenloses Getriebe" verfügen sollen, das doch bei großen Motoren eine Selbstverständlichkeit ist.
Daß ich meinen Steigflug wohlgetrimmt geflogen habe, ist bereits erwähnt. Der Trimmhebel liegt an der gleichen Stelle wie bei der RF-4 D, aber ich hatte seine Wirksamkeit damals etwas kritisiert. Bei der RF-7 befriedigt sie voll über den ganzen Bereich, und nur eine Umdrehung des Hebels erleichtert die Bedienung. Allein mit der Trimmung läßt sich die Maschine gut um die Querachse steuern.
Kunstflug? Aber gerne doch!
Inzwischen hatte ich mich von allen Wolken „freigeflogen" und tastete mich an die Mindestgeschwindigkeit heran. Mit Leistung, Fahrwerk eingefahren, schüttelte die RF-7 bei 75 km/h in einer schon steilen Lage unübersehbar im Leitwerk und ging danach gerade auf die Schnauze. Fast ist ein Sackflug möglich. Das gleiche Verhalten zeigte sich bei ausgefahrenem Fahrwerk und Gas auf Leerlauf, nur gab der Fahrtmesser 85 km/h an. Die RF-7 neigt nicht dazu, wegzudrehen. Das zeigte sich auch beim Einleiten des Trudelns. Man muß sie schon steil herannehmen und hart ins Seitenruder treten, um sie zum Drehen zu bringen. Den Knüppel am Bauch, erzielte ich drei sehr schnelle Umdrehungen, aber beim Nachlassen auf Neutralstellung der Steuer ging die Maschine exakt nach einer Viertel-Umdrehung heraus. Da inzwischen die starke Bewölkung aus der Nähe des Platzes verschwunden war, nahm ich meine Geschwindigkeitsmessungen in Richtung Binz, damit ich das Kunstflugprogramm dann über dem Platz abwickeln konnte. Die RF-7 nahm schnell Fahrt auf und erreichte als Dauergeschwindigkeit folgende Werte in 1000 m NN: bei 2600 U/min circa 145 km/h, bei 3000 U/min ca. 165 km/h, bei 3200 U/min ca. 185 km/h, bei 3400 U/min ca. 200 km/h, bei 3600 U/min ca. 205 km/h. Die höchste Dauergeschwindigkeit mit Verstellpropeller dürfte wohl der errechneten entsprechen: 210 km/h. Alle diese Werte sind schon mit dem starren Propeller gut, und die Reisegeschwindigkeit von 210 km/h für die Serie stellt schon eine kleine Sensation für ein solches Flugzeug dar.
Das Motorgeräusch ist nicht gerade gering, liegt aber durchaus im normalen Bereich, und der Motor klingt kerngesund. Der sichere Bereich für alle Manöver reicht bis 180 km/h, während sich der Vorsichtsbereich von 210 km/h bis zur vorläufigen Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erstreckt.
Über dem Platz angekommen, sah ich befriedigt, daß ein letzter Cumulant in reifen Formen das Ende der starken Schauertätigkeit ankündigte. Aber gleichzeitig lockte er mein Segelfliegerherz, und so schoß ich mal schnell hinüber, direkt unter die Wolke. Nach kurzem Hochziehen und Fahrtwegnahme auf 100 km/h stellte ich den Motor ab. Die Latte drehte noch etwa 15 Sekunden nach und blieb endlich stehen. Herrlich, diese Ruhe, noch herrlicher aber war der Einmeter-Bart, den ich erwischt hatte und den ich mit etwa 30 Grad Schräglage ausflog. Eine Leistungsmaschine hätte natürlich 1,5 m/s Steigen mehr auf dem Vario gehabt, aber ich saß ja in einer Motormaschine. Die RF-7 liegt sehr stabil beim Kreisen, so daß Gegenstützen kaum nötig ist, aber diese Fliegerei gehört nicht zu ihrem Metier. Ich kurbelte den Aufwind aus und flog mit Nullanzeige aus dem Schatten unter der Wolke wieder hinaus in die strahlende Sonne, die in diesem Frühjahr so großen Seltenheitswert hat. Aus den aufgelösten Cumuli hatten sich hier und da lange Schichtwolkenbänke gebildet, und die Luft war ruhig geworden. Mein kleiner Renner flog immer noch mit stehender Latte und sank nun konstant mit 2 m/sec Vario-Anzeige bei 100 km/h. Bei 110 km/h Geschwindigkeit stoppte ich die Wendigkeit von 45 Grad zu 45 Grad. Die Stoppuhr zeigte im Schnitt 2,1 Sekunden, was der geringen Spannweite von nur 9,4 m entspricht. Wieder über Platz schaltete ich die Zündung ein und ließ den Motor wieder an. Er ist sehr startfreudig, und wieder zeigte sich schon nach kurzer Laufzeit, daß das voll abgekühlte Triebwerk erheblich schneller warm wird als die Motoren der RF-4 D und der RF-5. Bei den geringen Außentemperaturen läßt das den Schluß zu, daß die Öltemperatur von 90° C bei Reiseleistung im Sommer wahrscheinlich nicht gehalten werden kann und daß sie beim Steigflug dann erheblich höher sein wird. Aber das sind ja die typischen „Kleinigkeiten", die bei der Flugerprobung beseitigt werden.
Ich überprüfte nochmals alles und schnallte die Gurte fest. Mit 220 km/h zog ich weich hoch zum Looping. Der Looping läßt sich rund fliegen, und ich kam ohne Höhenverlust wieder heraus. Anschließend folgte ein steiler Turn, bei dem man nicht zu spät ins Seitenruder treten darf. Ein echter Stall-Turn war nicht möglich, aber überraschenderweise stotterte der Motor keineswegs, obwohl ich hierbei etwas auf den Rücken kam. Gesteuerte Rollen links und rechts lassen sich einwandfrei um den Punkt drehen, und sogar Viertelrollen macht die RF-7 sauber mit, wenn die Geschwindigkeit beim Einleiten nicht zu gering ist. Auch hier setzte erstaunlicherweise der Motor in Rückenlage nicht aus, und sowohl Querruder als auch Seitenruder sind in der Wirkung ausreichend. Die Steuerdrücke sind durchweg, auch in ihrer Progression, beim Kunstflug angenehm bis gering. Die Ruderwirkung kann als harmonisch gelten, die des Seitenruders dürfte für den Kunstflug etwas größer sein. Die Stufung der Wirksamkeit ist Querruder, Höhenruder, Seitenruder. Mit Abschwüngen ließ ich mich ab. Die große Haube, die schon bei der RF-4 D überzeugt hat, ermöglicht eine hervorragende Sicht, und bei diesem Flug unterstützte sie auch noch die Heizung; solange ich in der Sonne flog. Andererseits ist aber die Lüftung bei Sommerbetrieb überdurchschnittlich gut, wie bereits von der RF-4 D her bekannt.
Das unfreundliche Wetter hatte keinen Fliegersmann gelockt; so war am Platz absolut kein Betrieb, und ich konnte im Tiefflug einmal am Platz vorbeizischen, ehe ich zum Landeanflug überging. Mit 110 km/h fuhr ich das Fahrwerk aus, dessen Hebel nach der Entriegelung mit Schwung nach vorn kommt, so daß ein leichter Druck nach vorn genügt, um es einzurasten. Eine Fahrwerkslampe und ein Summer warnen davor, den Vogel auf den Bauch zu schmeißen. Nimmt man bei ausgefahrenem Rad auch noch die auf der Oberseite ausfahrbaren Störklappen voll heraus, so sind steile Anflüge ohne Fahrtaufnahme mit einer Sinkgeschwindigkeit von 5 m/sec möglich. Lastigkeitsänderungen treten hierbei nicht auf. Die Landung ist leicht, und mit 80 km/h setzte sich der Prototyp weich auf das rauhe Feld. Die hohen Stützbügel mit den großen Rollen erlauben eine nahezu horizontale Lage am Boden. Die Sicht nach vorn ist dabei mittelmäßig.
Viel Licht, wenig Schatten
Als Ergänzung möchte ich noch einige Dinge aufzählen, die allerdings von der RF-4 D schon bekannt sind. So ist der Gepäckraum hinter dem Sitz bei der RF-7 nicht allzu groß, aber für einen Sportflieger ausreichend. Weder die Pedale sind verstellbar, noch die Rückenlehne, aber es wird ein Satz von vier Kissen mitgeliefert, so daß, wenn auch umständlich, eine angenehme Sitzposition gefunden werden kann. Der Aufbau der Zelle ist konventionell in Holzbauweise. Der durchgehende Flügel ist hinten mit Stoff bespannt und mit vier Bolzen an dem in Holzschalenbauweise gefertigten Rumpf montiert. Die Motorverkleidung besteht aus GFK, und das Leitwerk wurde unverändert von der RF-4 D übernommen. Der im Prototyp eingebaute Motor SL 1700 D entwickelt 65 PS bei 3600 U/min und besitzt Doppelzündung, Drehstromgenerator und einen elektrischen Anlasser. Ein Rückenflugvergaser ist noch nicht verfügbar, jedoch für die Serie vorgesehen; ebenso sind regelbare Kühlklappen zu erwarten. Da eine lageunabhängige Ölversorgung ebenfalls erst für die Serie geplant ist, hilft man sich beim Prototyp mit Bardahl-Notschmierung. Die starre Luftschraube wird durch einen Verstellpropeller ersetzt werden, so daß die errechneten Leistungen, die der Prototyp noch nicht ganz erreicht, wohl auch zu erwarten sind.
Die hervorstechenden Daten der RF-7, die etwa DM 32.000,- kosten wird, sind ihre hohe Reisegeschwindigkeit von etwa 210 km/h bei einer Reichweite von etwa 700 km. Dazu kommt die Zulassung für Kunstflug. Damit gelangt ein Flugzeug auf den Markt, das einen Vergleich mit anderen Maschinen in dieser Klasse zunächst deshalb nicht zuläßt, weil etwas Vergleichbares nicht in Serie gefertigt wird. Das ist die große Chance der RF-7, denn die absoluten Leistungen und die Eigenschaften sind ausgezeichnet, und ihre Vielseitigkeit macht sie interessant sowohl für Einzelbesitzer als auch für Fliegergruppen. Die RF-7 ist als schnelle, kleine Reisemaschine genauso gut geeignet wie als Trainingsmaschine für Kunstflug. Aufgrund dieser Vielseitigkeit kann sie Motorfluggruppen als preiswerte Zweitmaschine dienen. Der Flugstundenpreis dürfte bei jährlich 400 Einsatzstunden etwa bei DM 25,- bis 30,- liegen. Gute Erfahrungen bezüglich der leichten Wartbarkeit der robusten Zelle liegen von der RF-4 D vor. Der neue Motor dürfte aufgrund seines Aufbaus aus VW-Motorteilen auch keine allzu großen Überraschungen bringen, so daß die überschlägliche Preiskalkulation für die Flugstunde als realistisch bezeichnet werden kann. Mit diesen Eigenschaften: Vielseitigkeit, Anspruchslosigkeit und Leistungsfähigkeit, noch dazu bei einem auch für schmale Geldbeutel erschwinglichen Flugstundenpreis, kann sich die RF-7 den Erfolg erzwingen. Die Firma Sportavia-Pützer wird mit Beginn der Serienfertigung der RF-7 dann über ein breit gefächertes Lieferprogramm verfügen:
- RF-4D, Motorsegler, einsitzig
- RF-5, Motorsegler, doppelsitzig
- RF-7, Motorflugzeug, einsitzig
- SFS 31 Milan, Leistungsmotorsegler, einsitzig
- SF 25 B Falke, Lizenzbau der Firma Scheibe-Flugzeugbau, Motorsegler, doppelsitzig
Was die Zukunft angeht, so war zu hören, daß ein doppelsitziger Leistungsmotorsegler als völlige Neuentwicklung auf dem Reißbrett ist. Aufgrund der bisherigen Erfolge von Sportavia-Pützer darf man gespannt sein, was für ein neues Ei da in der Eifel ausgebrütet wird.
Dieter Schmitt (FLUG REVUE 7/1970)
Anmerkung der Redaktion: Das Projekt RF-7 wurde eingestellt, zu einer Serienproduktion kam es nicht.