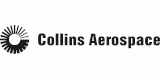Der letzte Regenschauer peitschte über den Platz, als die graue A400M am 19. Dezember aus den tief hängenden Wolken auftauchte und um 14:15 Uhr auf der Bahn 26 in Wunstorf aufsetzte. Oberstleutnant Christian Schott und Hauptmann Mirco Friese waren am Vormittag im sonnigen südspanischen Sevilla gestartet, um die „54+01“ (Seriennummer MSN18) nach Deutschland zu bringen und damit eine neue Ära im Lufttransport der Luftwaffe einzuläuten.
„Die A400M wird für die Luftwaffe und damit für die Bundeswehr deutlich mehr leisten und somit der Politik zusätzliche militärische Handlungsoptionen bieten“, zeigte sich Generalleutnant Karl Müllner, der Inspekteur der Luftwaffe, überzeugt. „Gegenüber der Transall wird die A400M mehr als die doppelte Ladung fast doppelt so schnell fast doppelt so weit transportieren. Der Zugewinn an Möglichkeiten ist offensichtlich.“ Laut Müllner geht es nun darum, „die A400M möglichst rasch zuverlässig und unter Einsatzbedingungen betreiben zu können“, denn „die Feuertaufe … wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen“.
Zunächst stehen beim Lufttransportgeschwader 62, wo man sich seit Jahren auf die A400M vorbereitete, die Einsatzprüfung und die ergänzende Nachweisführung für spezifisch deutsche Ausrüstungen an. Die TTVG (Technisch Taktische Versuchsgruppe) kann dafür bereits auf 16 Luftfahrzeugführer und zehn Technische Ladungsmeister sowie zahlreiche Techniker zurückgreifen, die seit 2013 bei Airbus in Sevilla ausgebildet wurden. Sechs Monate und um die 135 Flugstunden sind für die notwendigen Prüfungen vorgesehen, bei denen es nicht um „klinische Tests“ geht, sondern darum, Erfahrungen unter realen Bedingungen und bei normalen Betriebsabläufen zu sammeln. Das Spektrum reicht von einfachen Wartungschecks über die Durchführung von Enteisungsverfahren und der Beladung bis hin zu Streckenflügen, zunächst in Deutschland und schließlich weltweit.
Die Piloten haben dabei noch den einfachsten Job, ist Oberstleutnant Christian Schott überzeugt. Auch wenn die A400M im Cockpit mindestens zwei Generationen weiter ist als die Transall, sei die Umschulung problemlos mit Simulatorstunden und nur einem Flug mit sechs Landungen zu bewerkstelligen. „Die Größe der Maschine spürt man nicht“, so Schott, denn sie sei deutlich leistungsstärker und agiler als die Transall. Auch die Steigrate sei besser. Natürlich sind die Systeme komplexer, aber sie bieten der Crew auch mehr Hilfestellungen dank Automatismen.
Die moderne Technik erfordert eine Umstellung bei der technischen Betreuung, denn das Geschwader soll 40 A400M mit demselben Personal wie bisher seine 24 Transall betreiben. Eine „ganz neue Welt“ tue sich „mit einem kompletten Philosophiewechsel“ auf, denn der neue Transporter wird erstmals in der Bundeswehr entsprechend den European Military Airworthiness Requirements (EMAR) betrieben. Dies wird eine höhere Interoperabilität der europäischen Luftwaffen ermöglichen und soll kostengünstiger sein.
Unterstützt wird das Luftwaffenpersonal durch die Industrie. Gerade noch rechtzeitig wurden am 12. Dezember 2014 ein Systembetreuungsvertrag und ein Materialversorgungsvertag mit Airbus Defence & Space (Airbus Military Deutschland) abgeschlossen. Sie laufen bis Dezember 2018 und haben einen Wert von bis zu 645 Millionen Euro. Darin enthalten sind Dienstleistungen im Bereich Instandsetzung und Wartung, ein Serviceteam in Wunstorf und der Betrieb eines Ersatzteillagers.
Verzögerungen von bis zu sieben Monaten
Parallel zur Erprobung der A400M laufen in Wunstorf die letzten Vorbereitungen für die Ausbildung sowohl der Techniker als auch der Piloten und Ladungsmeister. Zum Juli will man „ready for training“ sein, wobei man bald auch französische Schüler erwartet. Eine Vereinbarung mit der Armée de l´Air sieht vor, dass das gesamte technische Personal beider Länder beim LTG 62 geschult wird. Ab 2017 erhalten auch französische Piloten ihre Umschulung in Wuns-torf, während deutsche Crews die weiterführende fliegertaktische Ausbildung mit ihren Kollegen in Orléans absolvieren werden. Der Unterricht wird dabei durchgehend in Englisch abgehalten.
Es gibt also viel zu tun, und der Inspekteur der Luftwaffe drängt darauf, „dass die Flotte nun möglichst rasch aufwächst, wie es vertraglich vereinbart ist“. Fünf Flugzeuge wollte die Luftwaffe 2015 übernehmen, doch Mitte Januar tauchten erstmals Zweifel auf, ob Airbus Defence & Space diesen Plan halten kann. Interne Analysen der für die Beschaffung zuständigen europäischen Rüstungsagentur OCCAR zeigen wohl, dass es beim Produktionshochlauf Schwierigkeiten gibt – angeblich schafft das Werk Bremen derzeit nur 0,7 Rumpfmittelteile pro Monat. Sollten sich Verzögerungen von bis zu sieben Monaten bewahrheiten, würde die Luftwaffe in diesem Jahr nur zwei A400M erhalten, eventuell auch gar keine.
Die A400M, die im Laufe ihrer langen Geschichte den Luftstreitkräften und dem Hersteller schon so viel Ärger gemacht hat, kommt also anscheinend immer noch nicht in ruhiges Fahrwasser. Im November gestand Harald Wilhelm, Finanzchef der Airbus Group, ein, was schon erwartet wurde: Die nächste Entwicklungsstufe, der sogenannte SOC1 (Standard Operational Capability) wurde bis zum notwendigen Termin 1. November nicht zugelassen, und die europäischen Kundennationen hätten damit sogar ein Kündigungsrecht. Flugzeuge auf Firmenkosten nachzurüsten sei nicht gerade der kostengünstigste Weg, so Wilhelm, der weitere Abschreibungen auf das Programm nicht ausschloss. Die Bilanz 2014 wird am 27. Februar veröffentlicht.
Ungeachtet dessen preist Airbus die A400M als „das effizienteste und flexibelste Transportflugzeug, das je gebaut wurde“. Diese Einschätzung ist wohl nicht verkehrt, wenn denn das Muster in den kommenden Jahren schrittweise alle beauftragten Fähigkeiten erlangt. Noch stehen zum Beispiel die Zulassung für Lastenabwürfe und das Absetzen von Fallschirmjägern, die Luftbetankung, die Einrüstung von Selbstschutzsystemen und Panzerung, die Luftbetankung und der taktische Tiefflug aus. Erst gegen Ende des Jahrzehnts dürfte dies alles möglich sein.
FLUG REVUE Ausgabe 03/2015