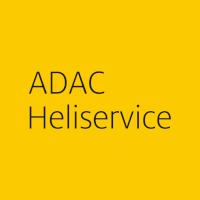Als die USS Abraham Lincoln (CVN-72) wenige Tage vor Trainingsbeginn ihren Heimathafen North Island in San Diego verließ und in den Pazifik vor die mexikanische Küste verlegte, war es an Bord ungewöhnlich leer. Üblicherweise ist der Flugzeugträger vollgepackt mit 65 bis 70 oder mehr Jets. Doch für die folgende Woche ging es auf eine besondere Fahrt: Die sogenannte "Fleet Replacement Squadron Carrier Qualification" stand an. 20 "Aviators", wie die Piloten bei der Navy im Amerikanischen genannt werden, wollten auf See nahe der Halbinsel Baja California ihre Qualifizierungsprüfung zur Trägerlandung absolvieren.
"Flying Eagles", "Rough Raiders" und "Vikings"
Nur wenige Stunden nach dem Auslaufen der USS Abraham Lincoln wurde es laut auf dem Flugdeck. Nach und nach trafen die verschiedenen Maschinen der einzelnen Verbände ein. Aus Lemoore in Kalifornien kamen fünf Boeing F/A-18E/F Super Hornets des Strike Fighter Squadron 122 (VFA-122) "Flying Eagles" sowie drei Lockheed Martin F-35C Lightning II des Strike Fighter Squadron 125 (VFA-125) "Rough Raiders" und aus Whidbey Island in Washington fünf Boeing EA-18G Growler des Electronic Attack Squadron 129 (VAQ-129) "Vikings". Bis zum Sonnenuntergang flogen die Jets immer wieder Platzrunden mit abschließender Landung auf dem Flugdeck des Trägers. Die Maschinen hatten dabei nur wenig Pause. Waren sie gerade nicht in der Luft, warteten sie mit laufenden Triebwerken auf den nächsten Start. Sobald das Katapult frei war, wurden sie wieder in die Luft für die nächste Platzrunde geschickt. Mehr Pause dagegen hatten die Piloten. Sie wechselten sich regelmäßig ab und konnten die Jets für ihre Pausen auch verlassen.

Trainingsziel: Lizenz zum Landen
Unter den Piloten befanden sich sowohl Neulinge, welche gerade erst ihre zweijährige intensive Schulung für den Einsatz auf Navy-Flugzeugen absolviert hatten und nun ihre ersten realen Trägerlandungen durchführten, als auch langjährige Piloten, die durch längere Pausen ihre zeitlich begrenzt gültige Trägerlizenz verloren hatten. Die Jets, die zum Einsatz kamen, gehörten Trainingsstaffeln und waren für die Ausbildung der Piloten aus den verschiedensten Verbänden der USA bestimmt. Die Maschinen werden jedoch regelmäßig mit den Einsatzstaffeln durchgetauscht, um die Stundenanzahl gleichmäßig zu verteilen. Doch nicht nur amerikanische Piloten kommen zum Training zu diesen Staffeln, auch Piloten aus dem Ausland werden von diesen für die Trägerlandung geschult, wie etwa Schweizer F-18-Piloten.

Ein Stück Metall im Ozean
Auch Lieutenant Elise Walker musste ihre Trägerlizenz erneuern – und schwebte mit ihrer F-35C auf der "Lincoln" ein. "Man ist immer ein bisschen nervös, wenn man auf diesem kleinen Stück Metall mitten im Ozean landet. Auch nach vielen Malen", verriet sie. "Wenn man das Fangseil erwischt, fühlt es sich an wie bei einem Autounfall und deine ganzen Beine zittern." Bei den ersten Starts und Landungen sei die Anspannung noch sehr groß. "Aber es macht dann um so mehr Spaß, wenn sich die Nerven beruhigt haben."
Gestartet wurde lediglich von einem einzigen der vier Katapulte, und zwar vorne am Bug. Denn durch die ständigen Platzrunden wurde die Landebahn, auf der sich die restlichen zwei Katapulte befinden, permanent gebraucht. Das Katapult auf der USS Abraham Lincoln ist noch dampfbetrieben. Der Wasserdampf ist ein Erzeugnis des Kernreaktors, der den Flugzeugträger antreibt. Klassisch dampft es permanent aus den Spalten am Flugdeck. Zwangsläufig kommt beim Besucher "Top Gun"-Feeling auf. Tatsächlich wurde der neue Kinofilm "Top Gun: Maverick" zum Teil auch auf der "Lincoln" gedreht.

Fanghaken raus, Fullstop-Landung!
Um den Neulingen möglichst viel Freiraum zu gewähren, kehrte der überlicherweise sonst an Bord stationierte Carrier Air Wing 9 (CVW-9), bestehend aus F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C Lightning II, E-2D Hawkeye, MH-60R und CMV-22B, zu seinen jeweiligen Heimatbasen zurück. Somit stand für die Trainingsflüge ausreichend Platz zur Verfügung. Lediglich drei MH-60S Seahawk der Helicopter Sea Combat Squadron 14 (HSC-14) "Chargers" blieben an Bord, um SAR-Dienste für die Trainingsflüge zu leisten. Um die neuen Piloten langsam an die Trägerlandungen heranzuführen, übten sie anfänglich nur Touch-and-Go-Manöver, um ein Gefühl für den Anflug zu bekommen. Erst dann wurde der Fanghaken ausgefahren, um Fullstop-Landungen zu trainieren. Durch die Landungen mit Fangseil entstehen hohe Belastungen für die Flugzeuge. 130 Knoten (240km/h) werden innerhalb von nur drei Sekunden auf Null abgebaut. Daher sind die Navy-Jets in der Struktur verstärkt, haben ein robusteres Fahrwerk sowie einklappbare Tragflächen und sind demensprechend um einiges schwerer als z.B. die gleichen Muster bei der Air Force. Das führt zwar einerseits zu Nachteilen bei der Kampfführung und Reichweite, andererseits aber überwiegt der Vorteil der trägerbasierten Flexibilität. Nach 125 Landungen muss jedes Seil ausgetauscht werden.

Durchblick auch bei Nacht
Der schwierigste Teil der Qualifizierung waren die Nachtflüge. Anders als Flughäfen an Land ist das Flugdeck des Trägers kaum beleuchtet. Einerseits um die Piloten nicht durch zu viele Lichtquellen abzulenken, andererseits um sich einem möglichen Feind nicht sofort preiszugeben. Nur die notwendigsten Lichtquellen sollen die Piloten sicher aufs Deck führen. Da sich der Flugzeugträger auf dem pechschwarzen Ozean befindet, gibt es kaum Referenzen, um die Höhe und Fluglage für die Landung einzuschätzen. Die Piloten müssen sich dabei voll und ganz auf die Anfluglichter konzentrieren, die vom Landesignaloffizier (LSO), gesteuert werden. Unterstützt werden sie dabei in allen Jets seit kurzem von der neuen Software "Magic Carpet" (Zauberteppich). Mittels dieser erfolgen die Anflüge zum größten Teil automatisiert und die Piloten müssen deutlich weniger Steuereingaben machen als zuvor.

Noch lange kein altes Eisen
Bisher versorgten fast ausschließlich die Grumman C-2A Greyhounds die Flugzeugträger der Navy mit Materialnachschub und Personal. Wie die Jets landen auch sie mit Fangseil und starten mit Katapult. Da die Greyhounds mittlerweile in die Jahre gekommen sind und auch der Passagiertransport angenehmer gestaltet werden soll, lösen nun Schritt für Schritt Bell-Boeing CMV-22B Ospreys die alten Flugzeuge ab. Die USS Abraham Lincoln ist der erste Flugzeugträger der Navy, der bereits komplett auf die Osprey als COD (Carrier Onboard Delivery) umgestellt hat. Die Osprey wird von der Schiffsbesatzung deshalb aus Spaß auch "CODsprey" genannt.
Mit ihren 39 Jahren gehört die USS Abraham Lincoln noch lange nicht zum alten Eisen. 1984 begann die Kiellegung, gefolgt von der Indienststellung am 11. November 1989. Die Lebensdauer von 50 Jahren begründet sich in der Laufzeit der Kernreaktoren, welche das Schiff antreiben. Die Brennstäbe sind für zweimal je 23 Jahre ausgelegt. Für deren Austausch nach Ablauf der Haltbarkeit war im Jahr 2013 ein fast vier Jahre dauernder Werftaufenthalt notwendig. In diesem Zeitraum wurde das Schiff auch grundüberholt. Seitdem ist es wieder einsatzklar und muss bis zu seinem Dienstende im Jahr 2038/39 weder auftanken noch umständlich an Land gewartet werden, sofern keine unvorhergesehenen großen Schäden auftreten.

Kleinstadt auf hoher See
Allein die Schiffsbesatzung zählt etwa 3.000 Seeleute. Ist der CVW-9 an Bord, sind es knapp 6.000. "Es ist eine richtige Kleinstadt", schwärmte F-35C-Pilotin Elise Walker. "Ich könnte im Cockpit ohne die ganzen Leute an Bord nicht erfolgreich sein." Jeder einzelne der Seeleute erfüllt eine wichtige Aufgabe an Bord des Schiffes. Die vorbildliche Zusammenarbeit der gesamten Mannschaft zeigt sich in der perfekten Funktionalität des Flugzeugträgers. Die schiffseigene Werkstatt kann fast alle schiffsbezogenen Reparaturen selbst durchführen. Auch die Kampfjets können an Bord gewartet werden – selbst dann, wenn große Reparaturen anstehen, wie der Austausch einer Tragfläche.
Um schnell wieder einsatzfähig zu sein, werden auch permanent bis zu vier Jet-Triebwerke im sogenannten Jetshop vorgehalten. Nur drei Stunden dauert der Austausch eines Triebwerks bei der F/A-18. In einem Teststand können die Triebwerke auf Funktionalität überprüft werden, sogar unter Volllast. In der Bordklinik stehen bis zu 52 Betten für Verletzte bereit und in der eigenen Zahnklinik können auch kleine Operationen durchgeführt werden. Da es bei so vielen Menschen an Bord auch einmal zu kriminellen Handlungen kommen kann, gibt es sogar Arrest-Zellen. "Alle ein bis zwei Wochen kommt es vor, dass sich einer der Seeleute nicht an die strengen Regeln hält und wir ihn oder sie dann einsperren müssen, bis der nächste Transport an Land zur Verfügung steht", berichtet der zuständige Master at Arms, wie der Soldat mit Polizeibefugnis an Bord genannt wird.
Das Durchschnittsalter an Bord beträgt lediglich 21,8 Jahre. Die erst 24-jährige Seekadettin Rebekah Kaiser vertrat während der Carrier Qualification Kapitänin Amy Bauernschmidt in deren Dienstpausen und steuerte die USS Abraham Lincoln. "Üblicherweise fahren wir eine Geschwindigkeit zwischen 20 und 25 Knoten", verriet sie. "Wenn es aber darauf ankommt, können wir auch etwas über 30 Knoten schnell sein. Die Rollrate darf maximal 2 Grad betragen. Da der Träger aber äußerst stabil im Wasser liegt, können wir bei fast jedem Wetter fahren. Die Jets müssen immer gegen den Wind starten. Deswegen drehen wir für Starts und Landungen wenn möglich gegen den Wind. Ist das einmal wegen einer Einsatzfahrt nicht möglich, können wir auch mit dem Wind fahren und durch erhöhte Geschwindigkeit einen eigenen Fahrtwind von vorne für die Jets erzeugen."
Geschichtsträchtige Träger
Die USS Abraham Lincoln war bereits bei einigen Kriegseinsätzen weltweit dabei. So zum Beispiel 1991 im Golfkrieg (Missionen "Desert Storm" und "Operation Southern Watch") und ab 2003 im Irak (Missionen "Operation Iraqi Freedom" und "Operation Enduring Freedom"). Doch nicht nur im Kriegseinsatz wurde der Flugzeugträger eingesetzt. Auch Rettungsmissionen spielten eine wichtige Rolle. So nahm die "Lincoln" 1991 bei Rettungsmaßnahmen nach dem Ausbruch des Vulkans Pinatubo auf den Philippinen teil und war 2004 bei Hilfseinsätzen in Indonesien zur Stelle.
Nach wie vor stellen Flugzeugträger für die USA ein ideales Mittel dar, um weltweit Macht und Stärke zu demonstrieren. Oftmals reicht schon allein die Präsenz eines Flugzeugträgers aus, um einen Konflikt zu entschärfen. Durch Träger ist man nicht auf die Unterstützung anderer Länder angewiesen, wenn es um die Genehmigung zur Benutzung fremder Militärflugplätze oder Lufträume in anderen Ländern geht. Zudem ist der "schwimmende Flughafen" mobil und kann an fast jeden Ort der Welt entsandt werden. Immerhin bestehen rund 70 Prozent der Erdoberfläche aus Ozeanen.