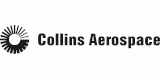Innerhalb von zwei Jahren wollen wir ein kleines Testflugzeug völlig autonom fliegen lassen – vom Pushback über das Anlassen, Rollen, Starten, Fliegen, Landen, Zurückrollen und Parken“, kündigt Boeing-Entwicklungsvorstand Mike Sinnett beim Interview mit der FLUG REVUE in Köln an, ohne ein Muster zu nennen. „Auch alle Anweisungen per Flugfunk werde das Flugzeug hören und verstehen können, diese umsetzen und per Funk antworten. Ein wahrscheinlich mitfliegender Sicherheitspilot werde den Flug nur noch passiv beobachten. Das Flugzeug werde sich, „genau wie bisher“ nach den üblichen Regeln im Luftverkehr bewegen, seine Steuerung und die Entscheidungsfindung erfolge aber ausschließlich an Bord, komplett unabhängig von Bodenstationen.
„Keine heutige Boeing kann vom Boden aus ferngesteuert werden, und das wollen wir so lassen“, sagt der leitende Forschungsingenieur. „Wir wollen keinerlei Außenverbindung, die versagen könnte. Wir brauchen unbedingte Zuverlässigkeit und Schutz vor Eingriffen.“ Die Zuverlässigkeitsanforderungen beim Militär, wo Drohnen bekanntlich oft durch Bodenstationen ferngesteuert werden, seien dagegen, im Vergleich zur zivilen Luftfahrt, weniger streng.
Wie viele Piloten sind genug?
Sinnett sieht die Forschung am autonomen Verkehrsflugzeug als längeren Weg, auf dem zunächst die Zahl der Piloten an Bord schrittweise reduziert werden könnte. „Bei einem heutigen Langstreckenflug – nehmen wir als Beispiel mal eine 777, die 16 bis 18 Stunden unterwegs ist – sind fünf Piloten an Bord. Manche fliegen, andere ruhen sich aus. Es kann sein, dass wir am Ende nur die Zahl dieser Ersatzpiloten verringern oder sogar die Gesamtzahl gleich lassen und nur die Informationen anders aufbereiten, damit die Piloten bessere Entscheidungen treffen können“, betont er das offene Ergebnis seiner Forschungsarbeit. Wirtschaftliche Aspekte oder Kosten seien in dieser Phase noch kein Teil der Überlegungen. Erst einmal gehe es um die technische Machbarkeit und um die Erhöhung der Sicherheit insgesamt.
Mike Sinnett beobachtet nicht nur einen weltweiten Pilotenmangel, sondern auch, dass die heutige Pilotengeneration weniger erfahren sei als ihre Vorgänger. „Wir könnten heute mit lernenden Maschinen und künstlicher Intelligenz die Informationen an Bord viel besser aufbereiten als früher und damit diesen Mangel an Erfahrung zum Teil kompensieren. Ob wir den Piloten einfach nur Empfehlungen geben oder eines Tages direkt in die Steuerung eingreifen, wird sich erst im Laufe dieses langen Weges zeigen“, sagt Sinnett. Der Computer habe sämtliche Informationen und könne viel schneller entscheiden als ein Mensch. Dafür müssten aber alle Bordsysteme elektronisch per Datenbus verknüpft sein. „Bei einer Boeing 777 gibt es noch eine mechanische Verbindung zum Öffnungsventil, wenn der Fahrwerkshebel betätigt wird“, sagt Sinnett. In einer Boeing 787 lägen dagegen mehr Daten elektronisch vor.
Wie reagiert ein Computer auf Überraschungen?
Bei schweren Störungen oder Systemausfällen sehe er keine Gefahr, den Computer durch unerwartete Situationen oder Datenmengen zu überfordern: „Auch heute können die Piloten, nur anhand QRH-Notfallhandbuch [Quick Reference Handbook – d. Red.] und Checklisten alle Lagen bewältigen. Wenn zu viele Störungen auf einmal auftreten, priorisieren wir auch heute schon die Handlungsanweisungen und verdichten die Aufgaben. Analog dazu macht es dann eben auch der Computer. Wir müssen alle Lösungen an Bord haben.“
Würde die Öffentlichkeit unbemannte Flugzeuge überhaupt akzeptieren? „Zuerst müssen wir uns erst einmal selbst überzeugen“, sagt Sinnett. „Falls uns das gelingt, können wir danach auch die Öffentlichkeit gewinnen.“ Sinnett, selbst ausgebildeter Linienilot, spricht viel mit anderen Piloten über das autonome Fliegen. „Die nennen uns die Lücken zwischen Flugzeug und Pilot. Was macht der Computer, wenn ein Passagier plötzlich einen Herzinfarkt erleidet oder wenn die Fracht anfängt zu brennen? Das müssen wir zuerst verstehen.“ Die Zulassungsbehörden seien gegenüber dem Thema autonomes Fliegen offen, sagt Sinnett. „Alle wollen begreifen, wie es gehen könnte, genauso wie wir.“
Boeing in Deutschland
Boeing eröffnete Ende November 2017 das neue Digital Aviation & Analytics Lab in Neu-Isenburg, unweit der Boeing-Tochter Jeppesen. 50 bis 60 Forscher entwickeln hier, in Zusammenarbeit mit Industriepartnern, Universitäten und dem DLR, Ideen für neue Dienstleistungen. Die Themen reichen vom vernetzten Drohneneinsatz über Airline-Flugbetriebsoptimierung, digitale Rollkarten bis hin zur „smarten“ Flugzeugkabine der Zukunft. Nach einem straffen Taktplan werden die besten Ideen ausgesiebt und bis zur Marktreife gebracht.
FLUG REVUE Ausgabe 02/2018