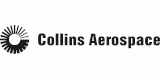Es war ein Wiedersehen am anderen Ende der Welt: Die Fliegende Sternwarte erreichte vergangenen Freitag um 11:05 Uhr Ortszeit den neuseeländischen Flughafen Christchurch, wie das DLR mitteilte. Das Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie (SOFIA) ist bereits zum vierten Mal zu Gast und wird bis zum 10. August 2017 Beobachtungsflüge absolvieren. Der modifizierte Jumbo hob am Montag zum ersten Wissenschaftsflug der diesjährigen Kampagne ab.
Die langen Winternächte in Neuseeland sind für die Weltraumbeobachtung bestens geeignet. Die Wasserdampfkonzentration in der irdischen Atmosphäre ist im Winter auf der Südhalbkugel viel geringer als sie in der Heimat des Fliegers ist. "Das sind ideale Voraussetzungen für ungetrübte Beobachtungen. Denn schon kleinste Mengen an Wasserdampf in der Luft können die Infrarotstrahlung aus dem All ‚verschlucken‘, sodass diese nicht mehr von den Spektrometern gemessen werden kann", so DLR-Projektleiter Heinz Hammes. In einer Flughöhe von rund 13 Kilometern fliegt SOFIA weitestgehend über dem Wasserdampf, so können Sternentstehungsgebiete wie die Große und die Kleine Magellansche Wolke ungetrübt betrachtet und untersucht werden.
Für die Beobachtungen werden an das Spiegelteleskop, das einen Durchmesser von 2,7 Metern hat, verschiedene Instrumente angeschlossen: die in Deutschland gebauten Ferninfrarotspektrometer GREAT (German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies) und FIFI-LS (Field-Imaging Far-Infrared Line Spectrometer) sowie das US-amerikanische Instrument FORCAST (Faint Object Infrared Camera for the SOFIA Telescope). Damit lässt sich die Gesamtdynamik der Sternentstehung untersuchen und spektrale "Fingerabdrücke" von Atomen und Molekülen nehmen, um Gasdichten, Temperaturen und Geschwindigkeiten der Wolken zu bestimmen.