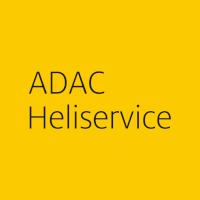Das war peinlich und ärgerlich“, sagt Tom Williams, Programmvorstand bei Airbus zu den Flügelproblemen der A380 bei der zweitägigen Fachpressetagung „Airbus Innovation Days“, Ende Mai 2012 in Toulouse. „Wir hatten gehofft, durch Rippen aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff 300 Kilogramm Strukturgewicht sparen zu können. Jetzt gibt es diese Haarrisse an den Rippenbefestigungen und die mit zunehmender Einsatzzeit auftretenden Typ-2-Risse. Es ist kein Sicherheitsproblem, man kann damit sicher fliegen, aber es ist ein Wartungsproblem. In jedem Flügelpaar stecken 4000 Befestigungen, davon sind unter 20 betroffen. Die Problemzone liegt jeweils innerhalb der äußeren Triebwerksaufhängung.“
Williams kündigt an, dass Airbus die Flügelrippenbefestigungen künftig aus Aluminium der Legierung 7010, statt zuvor 7449 fertigen werde. Die dafür neu konstruierten Rippenbefestigungen würden etwas dicker und insgesamt 89 Kilogramm schwerer. Ab Anfang 2013 werde man alle Rippenfüße in den schon fertigen Flugzeugen auf das verbesserte Material umrüsten. Außerdem entwickle Airbus für zukünftige A380 einheitliche neue Rippen aus Aluminium 7010.
Ab 2014 werde Airbus alle neuen A380 mit diesem verbesserten Flügel ausliefern. Die Flügel-Nachrüstung schon gebauter Flugzeuge versuche Airbus im Rahmen regulärer C-Checks „scheibchenweise“ zu verteilen, um den Airline-Kunden längere Bodenzeiten zu ersparen. Die Risse seien vor allem auf unerwartete thermische Alterungsprozesse im Flügel zurückzuführen, die im dynamischen A380-Ermüdungstest in Dresden, selbst nach 18 000 simulierten Flugzyklen, nicht aufgetreten seien. „Da gab es keine Risse. Aber dort gab es auch keine Temperaturunterschiede, wie bei einem Flugzeug, das erst bei 40 Grad in der Wüste parkt, dann startet, und nach einer Dreiviertelstunde bei minus 50 Grad auf Reiseflughöhe ankommt.“ Airbus habe zwar eigens einen zusätzlichen A380-Test-Flügelkasten, die sogenannte „Wingbox 8B“, mit Kraftstoff befüllt und in einer Klimakammer auf Alterung überprüft, aber auch hier seien die späteren Alterungsprozesse realer Flugzeuge nicht aufgetreten.
„Auch unsere damalige Software zur Finite-Element-Modellierung zeigte dies nicht an“, räumt Williams ein. „Jetzt haben wir aber eine verbesserte Non-Finite-Element-Modellierung für die A350 XWB. Deren Konstruktion ist auch ganz anders: Rippen aus Aluminium-Lithium und Kohlefaserflügel.“ Doch gebe es für die A380 auch eine gute Nachricht: Alle ab diesem Jahr ausgelieferten Flugzeuge seien insgesamt 800 Kilogramm leichter. „Wir sind sehr konzentriert dabei, das Flügelproblem zu lösen und zwar schnell“, sagt Williams, dem man sein ehrliches Bedauern anmerkt.
John Leahy, Chief Operating Offi cer Customers und damit Verkaufsvorstand hat noch zwei Asse für die A380 im Ärmel: So biete Airbus künftig eine neue Version mit von 560 auf 575 Tonnen erhöhter Startmasse an, die bis zu 8500 NM (15750 Kilometer) Reichweite schaffe. Dies reiche zum Beispiel für Nonstop-Flüge von Dubai nach San Francisco mit voller Zuladung. Außerdem offeriere Airbus die A380 künftig auf Wunsch auch als „Flüsterversion“ mit einer auf 490 Tonnen reduzierten Startmasse. Diese Mittelstreckenversion schaffe immer noch 5000 NM (9260 Kilometer) Reichweite, sei aber durch ihre geringe Masse und den geringeren Schubbedarf extrem leise. Beim Start erfülle sie den QC-1-Lärmwert in London-Heathrow, im Landeanflug schaffe sie sogar QC 0,5. Damit sei auch nächtlicher Flugbetrieb über Ballungsräumen möglich und eine bessere Ausnutzung der Flotte. Schon heute starte und lande alle acht Minuten eine A380. Eine Million Passagiere würden damit pro Monat befördert. Für den Airbus A350 XWB kündigte John Leahy die Indienststellung der Version
A350-900 für Mitte 2014, die der A350-800 für Mitte 2016 und die der A350-1000 für Mitte 2017 an. Die größte Version A350-1000 werde 25 Prozent weniger Kerosin pro Fluggast brauchen als Boeings Erfolgsmodell 777-300ER, ist sich Leahy sicher. Auf einer Beispielstrecke von Singapur nach London komme der Airbus mit 40 Tonnen weniger Startmasse aus, wirbt er für das neue Flaggschiff unter den Airbus-Zweistrahlern. Bestellungen für etwa 30 Flugzeuge aller A350-Versionen erwarte er im Lauf dieses Jahres. 5000 Ingenieure arbeiteten derzeit an diesem Schlüsselprogramm. Bis Mitte 2013 solle der erste fliegende Prototyp MSN001 komplettiert sein und dann ein Jahr lang im Flug erprobt werden.
Geriete Airbus mit der A350-1000 unter Druck, falls Boeing nun plötzlich eine modifizierte 777X mit verbessertem Flügel und neuen Triebwerken aus dem Hut zauberte? „Die würden das gleiche Problem haben, wie wir seinerzeit mit unserer ersten A350-Ausführung (vor der XWB) gegen die 787. Es bleibt ein alter Rumpf mit altem Flügel, der nur neue Triebwerke hat. Die A350-1000 ist dagegen komplett neu“, beantwortet Leahy die Frage der FLUG REVUE.
Die anhaltend hohe und sogar steigende Nachfrage nach dem klassischen Airbus A330 habe ihn zunächst überrascht, sagt John Leahy. Eine erhöhte Monatsproduktion von bis zu elf Flugzeugen ließe sich absetzen, so der Verkaufsvorstand. Doch diese ab Anfang 2014 denkbare Produktionserhöhung von heute 9,5 Flugzeugen lasse sich nur realisieren, falls bis dahin der weltweite Streit um die EU-Klimaschutzabgabe beigelegt sei, mahnt Leahy. Noch weit über das Jahr 2020 hinaus wolle Airbus die A330 parallel zur A350 anbieten.
A320-Serienfertigung wird auf Sharklet-Anbau vorbereitet
Die kleinste und meistverkaufte Airbus-Flugzeugfamilie, die A320, wird unterdessen auf den Anbau der Sharklets vorbereitet. Nach der schon beendeten Sharklet-Anfangsflugerprobung mit dem A320-Prototypen MSN0001 ist mittlerweile auch die erste Serien-A320 aus aktueller Produktion probeweise mit den Sharklets ausgerüstet worden. Die innen noch leere Kabine beherbergt eine Messwarte der Flugtestingenieure. Sie interessieren sich vor allem für die Lasten, die bei betont steilen Starts und Steigflügen mit hohem Schiebewinkel an den jeweils 2,4 Meter langen Sharklets auftreten.
Für die gesamte A320-Familie, bei der A318 aber nur für deren Ausführung mit CFM-Triebwerken, werden Sharklets angeboten. Die bei Korean Air Tech Center in Busan gebauten eigentlichen Sharklets sind immer gleich, aber die A321 hat eine veränderte Flügelbefestigung für die Strömungsverbesserer. Im Jahr 2012 werden bereits die Flügel von 100 Flugzeugen der A320-Familie auf den späteren Anbau von Sharklets strukturell vorbereitet. Die als Extra verkauften Sharklets kann man dann nachträglich jederzeit einfach montieren und eine modifizierte Softwareversion ins Flight Management System des jeweiligen Flugzeugs laden.
Laut Airbus-Verkaufsvorstand John Leahy habe sich der Marktanteil der europäischen Zweistrahlerfamilie gegenüber der Boeing 737 auf 70 Prozent erhöht. 1995 habe Boeing dagegen noch 80 Prozent dieses Marktes beherrscht. Airbus werde allerdings die 2011 eingegangene extreme Bestellmenge von insgesamt 1600 Flugzeugen in diesem Jahr nicht wiederholen.
Die langfristigen Absatzaussichten am Luftfahrtmarkt beurteilt Airbus trotz der momentanen Euro-Turbulenzen als sehr gut. So nehme weltweit die Zahl der sogenannten Mega-Cities, die jeweils mehr als 10 000 internationale Reisende pro Tag generierten, binnen 20 Jahren von heute 30 auf dann 90 zu. Dies erzeuge eine enorme Luftverkehrsnachfrage, rechnet der Airbus-Exekutivvorstand für Strategie und zukünftige Programme, Christian Scherer, vor.
Die Airbus-Entscheidung zum Bau der A320neo sei durch die staatlich geförderte Entwicklung neuer Wettbewerber am Markt geprägt worden. Die von Scherer nicht näher bezeichneten Wettbewerber, vermutlich C919 aus China und MS21 aus Russland, hätten aber den Fehler gemacht, in ihren künftigen A320-Konkurrenzmustern keine wirklich neuen Technologien anzubieten. Erst dieses Versäumnis der Konkurrenz habe es Airbus ermöglicht, die A320 für relativ überschaubare Entwicklungskosten von nur rund einer Milliarde Dollar nochmals zu überarbeiten, statt jetzt schon ein völlig neues Programm für etwa zehn Milliarden Dollar aufl egen zu müssen. „Mit dem gesparten Geld werden wir das nächste Flugzeug entwickeln, bevor die anderen sich am Markt etabliert haben“, verrät Scherer. „Nach der A320neo wird auch ein völlig neues Cockpitkonzept für die dann folgenden Jahrzehnte entwickelt und wir wollen damit die ersten sein“, ergänzt er auf Nachfrage der FLUG REVUE.
„Nichts ist so effizient wie Propeller“, äußert sich Scherer positiv zur Open-Rotor-Technologie, die er für einen A320-Nachfolger nicht grundsätzlich ausschließen will. Laut Airbus-Ingenieurvorstand Charles Champion erwägt der Hersteller sogar, im Rahmen des Forschungsprogramms Clean-Sky eine A340 zum Open-Rotor-Versuchsträger umzurüsten. Der Umbau sei aber noch nicht beschlossen.
Von der Lärmabstrahlung der gegenläufigen Open-Rotor-Triebwerke, möglicherweise auch in Pusher-Konfiguration, sei ihre optimale Montageposition abhängig. Die traditionelle Aufhängung unter den Flügeln werde nicht unbedingt beibehalten.
Als nächste Kraftstoff sparende Neuerung plane Airbus laut Christian Scherer aber das elektrische Rollen am Boden. Elektromotoren zum Rollen kämen aus Gewichtsgründen allerdings nur für Standardrumpfflugzeuge in Frage. Die höhere Masse eines Großraumjets schafften die Elektroantriebe nicht. Für größere Flugzeuge werde man eher sogenannte „Taxibots“ nutzen, führerlose Flugzeugschlepper, die sich aus dem Cockpit fernsteuern ließen und automatisch zur Ausgangsposition zurückkehren könnten. Scherer gibt zu bedenken, dass sich neun Prozent des Kraftstoffverbauchs in der Luftfahrt auch alleine durch eine bessere Luftraumorganisation und Flugsicherung einsparen ließen.
Um diese Flugzeuge entwickeln zu können und um den aktuellen Auftragsbestand von sieben Jahren voller Produktion abarbeiten zu können, braucht Airbus ständig neue Ingenieurinnen und Ingenieure. Bei der Personalsuche ziele man anteilig auf 40 Prozent junge Hochschulabsolventen und 60 Prozent Bewerber mit Vorerfahrung, berichtet Airbus-Personalvorstand Thierry Baril. Der Frauenanteil bei den Neueinstellungen liege aktuell bei 25 Prozent. Airbus beschäftige in Kooperation mit 600 Universitäten in jedem Jahr 3000 Praktikanten. Das Airbus-Karriereportal auf Facebook werde von 13 000 Fans verfolgt. Besonders gesucht seien momentan Strukturingenieure, Avionikingenieure und Systemingenieure. Um das Auswahlverfahren zu vereinfachen, habe man es bereits von zuvor 75 auf 35 Tage verkürzt. Aber auch für Flugzeugbauer ohne Hochschulabschluss gebe es eine erhebliche Stellennachfrage bei Airbus, die anteilig 30 Prozent des Bedarfs ausmache. Die relativ lange Verweildauer der Mitarbeiter im Unternehmen zeige, dass sich diese bei Airbus wohl fühlten.
„Der Vorrat an talentierten Leuten in Europa reicht für uns nicht mehr“, sagt der jüngst an die EADS-Spitze aufgestiegene bisherige Airbus-Chef Tom Enders. Airbus gründe deshalb in Indien zusätzlich eine sogenannte „Innovationszelle“ für Enwicklungsingenieure zukünftiger Flugzeugprogramme der Jahre 2030 bis 2050.
„Wir können nicht alles selber machen, sondern müssen uns auf den Kern konzentrieren“, sagt auch sein Nachfolger bei Airbus, Vorstandschef Fabrice Brégier, zur internationalisierten Unternehmensstrategie. „Sie werden keine andere Branche finden, die noch internationaler aufgestellt ist. Wir haben Mitarbeiter aus über 100 Nationen und 2000 weltweite Lieferanten. Vor fünf bis sechs Jahren hatten wir eine Wachstumskrise und dachten, wir schaffen das alles ganz einfach. Aber wir mussten uns erst einmal neu ausrichten, integrieren und die Partnerbeziehungen modernisieren, um die Produktion steigern zu können. Mit einem Euro-Wechselkurs von 1,30 bis 1,35 Dollar können wir heute Gewinne machen. Das war vor fünf Jahren anders.“
Tom Enders fordert, den Kundennutzen von Erneuerungen kritischer zu prüfen: „Erneuerungen sind eine zweischneidige Sache. Wenn man nichts erneuert, überholt der Wettbewerber. Als wir vor zehn Jahren Hybridrippen konstruiert haben, waren die das neueste, es sollte leichter sein. Wir waren zuversichtlich, dass wir das Material genau kannten. Wir haben auf die harte Tour herausgefunden, was wir noch nicht wussten. Es kostet richtig viel Geld und ich fürchte auch Reputation. Man braucht Leute, die was sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und man braucht Innovationen, die dem Kunden nützen.
FLUG REVUE Ausgabe 08/2012