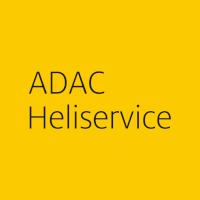Das Neonlicht macht die fensterlose, weiß ausgekleidete Kammer taghell. Kein Mensch ist zu sehen, als die Stille jäh vom Hochfahren einer Maschine unterbrochen wird. Was wie eine Szene aus dem Film „2001 – Odyssee im Weltraum“ anmutet, ist Hightech der Gegenwart. Ort des Geschehens ist ein Prüfstand beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln-Wahn. In der Mitte der Beruhigungskammer prangt ein Lufteinlauf mit dem Fan eines Triebwerks. Davor sind an einem halbkreisförmigen Bogen Mikrofone angeordnet. Mit diesem Aufbau wollen die Forscher eine neue Methode zur Minderung des Triebwerklärms erproben und dem sogenannten Blattfolgeton zu Leibe rücken. Dieser macht sich besonders im Landeanflug eines Flugzeugs durch ein unangenehmes Pfeifen bemerkbar.
Dabei umströmt die Luft die rotierenden Fanschaufeln. Hinter dem Rotor entstehen Bereiche, in denen eine kleinere Strömungsgeschwindigkeit herrscht als im Rest der Umgebung, die sogenannten Nachläufe. „Dieses Phänomen lässt sich auch auf Flüssen hinter Brückenpfeilern beobachten, wo ein Gebiet mit wenig Strömungsgeschwindigkeit entsteht, das Totwasser“, erklärt Professor Dr. Lars Enghardt vom DLR-Institut für Antriebstechnik.
Im Flugtriebwerk bewegt sich dieses Strömungsfeld spiralförmig nach hinten weiter, so dass auf den Stator abwechselnd ein schnellerer und ein langsamer Luftstrom trifft. „Dies ist, als ob man beim Fahrradfahren den Kopf immer wieder kurz aus dem Windschatten hebt und jedes Mal einen ordentlichen Schlag abbekommt. Auch im Triebwerk gibt es diese Druckstöße, und zwar genauso viele wie Rotorschaufeln vorhanden sind.“ Aus diesen Stößen entsteht ein regelmäßiges Geräusch mit einer typischen Frequenz von einem bis zwei Kilohertz, das die Ingenieure mit dem Prinzip der aktiven Lärmminderung abschwächen wollen. Dabei überlagert eine Sekundärschallquelle die Originalschallquelle. Nachdem sich die Methode mit Lautsprechern nicht als zielführend erwiesen hatte, kamen die Spezialisten auf eine andere Lösung. Mit der Einblasung von Pressluft aus dem Antrieb lässt sich ein Gebilde aus Luft konstruieren, das akustisch ähnlich wie eine stehende Schaufel hinter dem Fan wirkt und somit einen vergleichbaren Ton erzeugt. Wird er in geeigneter Stärke und Position angeregt, führt er zu einer zeitgenauen destruktiven Überlagerung der Schallquellen und auf diese Weise zu einer Auslöschung. Das Prinzip wurde nun beim DLR erprobt.
Für die Einblasung sorgten zwei eng hinter dem Fan angeordnete Ringe mit je einem Loch pro Leitschaufel. Sie lagen so nah wie möglich an der Rotorhinterkante, denn je größer der Abstand ist, desto mehr Luft muss eingeblasen werden. „Um den nötigen Ton darstellen zu können, muss man zwei bis drei Ringe einsetzen, weil die Akustik der Rotor-Stator-Interaktion eine relativ komplexe Struktur hat. Diese Struktur kann man durch verschiedene Freiheitsgrade definieren. Jeder Ring entspricht dabei einem Freiheitsgrad des Schaufelschallfelds“, sagt Professor Enghardt.
Ein typischer Fan besitzt heutzutage 18 bis 20 Rotor- und 40 bis 45 Leitschaufeln. Daher muss jeder Ring bis zu 45 Öffnungen aufweisen; sie werden mit einem durchgängigen Einblasmassenstrom versehen. Da der rotierende Fan automatisch für die korrekte Frequenz sorgt, muss die Regelung nur den Luftdurchsatz und die Position der Ringe steuern. Momentan erfolgt die Verstellung mechanisch. „Bei einem echten Flugzeug wäre dies keine Option.“ Stattdessen wäre eine Ventilkonstruktion mit wesentlich mehr Löchern denkbar, die nur die jeweils zur Kontrolle des Schallfeldes benötigten Öffnungen anspricht. Dies soll in einem neuen Forschungsprojekt getestet werden.
Die aktuellen Versuche waren der Höhepunkt des Projekts LeiLa (Leiser Luftfahrtantrieb). Im Rahmen des deutschen Luftfahrtforschungsprogramms LuFo IV arbeitet das DLR mit Rolls-Royce, MTU Aero Engines und Airbus Group Innovations seit Januar 2012 zusammen. Bereits 2012 testete man eine Versuchsanordnung mit einem Ring, die zwar die generelle Funktion nachweisen, aber nur eine lokale Schallreduzierung erzielen konnte. Mit dem aktuellen Aufbau erreichte das Team eine Reduzierung von bis zu zehn Dezibel in kritische Abstrahlrichtungen. In der menschlichen Wahrnehmung entspricht dies etwa einer Halbierung der Lautstärke.
Die Herausforderung des Systems liegt in seiner technischen Realisierbarkeit, da es allen Sicherheits- und Zulassungsanforderungen genügen muss. Außerdem soll es an- und abschaltbar sein. Schließlich ist die aus dem Triebwerk entnommene Zapfluft wertvoll, denn zu ihrer Erzeugung im Verdichter ist Energie, sprich Treibstoff nötig. Die Einblasung erzeugt zwar eine leichte Verbesserung der Effizienz im Fan, führt aber im Gesamtsystem zu einem etwas höheren Kraftstoffverbrauch. Dieser hält sich gemäß Professor Enghardt in Grenzen: „In unserem Versuch hat sich herausgestellt, dass überraschend wenig Luft zur Verfügung gestellt werden musste. Das Maximum lag bei 0,4 bis 0,5 Prozent des Gesamtmassenstroms.“
Ein weiterer Faktor muss mit dem Gewicht der zusätzlichen Zapfluftleitungen einkalkuliert werden. Der DLR-Forscher sieht gute Chancen für das System, auch wenn von der internationalen Luftverkehrsorganisation ICAO keine deutlich verschärften Lärmrichtlinien zu erwarten sind. „Zum einen hat ein Hersteller mit einem leiseren Antrieb einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei Airlines, die Flughäfen in dicht besiedelten Gebieten anfliegen. Zum anderen werden die Flughäfen in solchen Gebieten weiter die Marschroute mit Lärmgrenzen vorgeben, wie in Europa etwa London-Heathrow. In Zukunft wird auch die Frage des Flugbetriebs zu Tagesrandzeiten wichtiger. Dann kann so ein System helfen.“ Die aktive Lärmminderung könnte in 10 bis 15 Jahren realisierbar sein und bei der Nachfolgegeneration der Airbus-A320- und Boeing-737-Familien zum Einsatz kommen.
FLUG REVUE Ausgabe 05/2015
Druckluft gegen Lärm im Triebwerk :Aktive Lärmminderung im Test
Mit dem gezielten Einblasen von Luft will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) den vom Bläser erzeugten Lärm deutlich mindern. Die Ergebnisse der aktuellen Versuchskampagne sind positiv.
Veröffentlicht am 29.07.2015

Anzeige
Stellenangebote