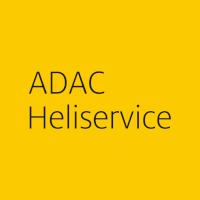Die neue Vega-C hob am 13. Juli um 10.13 Uhr (Ortszeit, 15.13 Uhr MESZ), am Ende eines zweistündigen Startfensters, vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou ab. Technische Probleme hatten dazu geführt, dass der Countdown zwei Mal angehalten werden musste.
Bei ihrem Erstflug beförderte die komplett überarbeitete Trägerrakete als Hauptnutzlast den Wissenschaftssatelliten LARES-2 der italienischen Raumfahrtagentur ASI sowie sechs CubeSats aus Frankreich, Italien und Slowenien in ihre jeweilige Umlaufbahn. Die Gesamtmasse der Nutzlast betrug beim Start nach Angaben der ESA etwa 474 kg: 296 kg für LARES-2, der Rest entfiel auf die sechs CubeSats, Nutzlastadapter und Trägerstrukturen. Die Mission dauerte 2 Stunden und 15 Minuten vom Start bis zum Aussetzen der letzten Nutzlast und der letzten Zündung des Oberstufentriebwerks AVUM+.
Mehr Leistung, mehr Nutzlast
Die Vega-C verfügt über eine neue erste (P120C) und zweite (Zefiro-40) sowie eine verbesserte vierte Stufe (AVUM+). Sie hat im Vergleich zu der seit 2012 eingesetzten Vega eine um 800 Kilogramm auf 2,3 Tonnen erhöhte Nutzlastkapazität in eine polare Referenzumlaufbahn von 700 Kilometern. Die Vega-C ist mit ihren größeren Hauptstufen und der größeren Verkleidung, die das Nutzlastvolumen im Vergleich zu Vega verdoppelt, 34,8 Meter hoch und damit fast 5 Meter höher als die alte Vega.
Durch die höhere Leistung und die größere Nutzlastkapazität kann die Vega-C größere Satelliten, zwei Hauptnutzlasten oder verschiedene Anordnungen für Rideshare-Missionen in die Umlaufbahn bringen. Der wiederverwendbare Raumtransporter Space Rider der ESA soll demnächst mit der Vega-C in den Orbit gebracht werden.
P120C wird auch für Ariane 6 genutzt
Die erste Stufe, P120C, basiert auf dem P80 der Vega. Das neue Feststoff-Raketentriebwerk kommt auch an der Ariane 6 als Booster zum Einsatz – zwei für die Konfiguration Ariane 62, vier für die Ariane 64. Die gemeinsame Nutzung dieser Komponente soll die Produktion der beiden Raketen effizienter machen und die Wirtschaftlichkeit erhöhen.
Die wiederzündbare Oberstufe wurde ebenfalls verbessert. AVUM+ verfügt nach Angaben der ESA über eine höhere Kapazität für Flüssigtreibstoff. So können Nutzlasten je nach Anforderungen der Mission in verschiedene Umlaufbahnen befördert werden, auch ist eine längere Betriebszeit im Weltraum möglich. Die AVUM+-Oberstufe setzt allerdings wie bereits die Oberstufe der Vorgängerin auf das RD-869-Flüssigkeitsraketentriebwerk des ukrainischen Herstellers Juschmasch.
Was passiert mit den ukrainischen Triebwerken?
Der Ukraine-Krieg sorgt jedoch auch hier für Unsicherheit. Man verfüge über einen Vorrat an Triebwerken, hatte Stafano Bianchi, Head of Flight Programmes Department bei der ESA, bei einer Pressekonferenz vor dem Start gesagt. "Die Kooperation mit der Ukraine geht weiter und wir wünschen uns auch, dass sie weitergeht." Allerdings arbeitet man bei der ESA und beim Vega-C-Hauptauftragnehmer Avio an Alternativen: Als langfristige Lösung entwickelt Avio das M10, das mit Methan und Flüssigsauerstoff betrieben wird und für die Vega-E bestimmt ist. Zudem untersuche man zwei Triebwerksoptionen als Backup-Lösung, so Bianchi. Um welche es sich handelt, gab der ESA-Manager nicht preis.
Der erste kommerzielle Start der Vega-C ist für November geplant, mit den Airbus-Erdbeobachtungssatelliten Pléiades Neo 5 und 6.