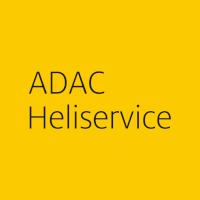Neue Herausforderungen
In den Jahren seit 2006 hat die Luft- und Raumfahrt so manche Schwierigkeiten überstanden. Vor allem die weltweite Finanzkrise ab 2007 sorgte für einen Einbruch bei den Airlines, der aber recht schnell wieder überwunden wurde. Jedenfalls konnten sich Airbus und Boeing in den letzten Jahren über eine zuvor nicht gekannte Auftragsflut freuen.
Mit dazu beigetragen haben neue Muster wie die 787 und die A350, die – wenn auch mit manchen Problemen und Verzögerungen – zur Serienreife gebracht wurden. Quasi nebenbei rüsteten die beiden Giganten ihre Erfolgsmodelle A320 und 737 mit neuen Triebwerken wie dem Getriebefan nach, was auch im Bereich der Standardrumpf-Flugzeuge für einen Auftragsschub sorgte. Derweil rüsten sich neue Konkurrenten wie die C Series und Entwürfe aus Russland und China.
Im Militärbereich gab es von westlicher Seite praktische keine wichtigen Neuentwicklungen. Angesichts der Probleme wie bei A400M oder der F-35 Lightning II galt es erst einmal, vorhandene Programme zum Erfolg zu führen. Immerhin flog in Russland mit der Suchoi T-50 ein neuen Fighter, und aus China gibt es diverse überraschende Entwicklungen wie die Chengdu J-20 zu vermelden. Derweil breitet sich die Nutzung unbemannter Fluggeräte aller Art weiter aus.
In der Raumfahrt hält die Internationale Raumstation die Stellung, bis sich die Pläne für bemannte Missionen zu Mond und Mars konkretisieren. Dafür rücken unbemannte Sonden immer wieder ins Rampenlicht, sie es der große Marsrover Curiosity der NASA oder Europas Kometenjäger Rosetta.
Den fünften Teil des Rückblicks (1996 - 2005) finden Sie hier...
Den vierten Teil des Rückblicks (1986 - 1995) finden Sie hier...
Den dritten Teil des Rückblicks (1976 - 1985) finden Sie hier...
Den zweiten Teil des Rückblicks (1966 - 1975) finden Sie hier...
Den ersten Teil des Rückblicks (1956 - 1965) finden Sie hier...
Doppelsieg für Airbus und Boeing

Mit jeweils mehr als 1000 neuen Bestellungen konnten Airbus und Boeing 2005 Rekordergebnisse verbuchen. Nach Stückzahl gerechnet führt Airbus, nach Listenwert Boeing. Nicht weniger als 1111 Jets „brutto“, das sind nach Abzug von Auftragsumwandlungen und Abbestellungen immer noch 1055 Flugzeuge „netto“, im Listenwert von 95,9 Milliarden Dollar schmücken die Verkaufsbilanz 2005 des europäischen Herstellers. Damit übertrifft Airbus erneut Boeing, wo kurz zuvor ebenfalls rekordverdächtige 1029 Bestellungen „brutto“ beziehungsweise 1002 „netto“ gemeldet worden waren. Den Ausschlag im ehrgeizigen Finale der beiden Branchenriesen gab die Einbeziehung eines chinesischen Großauftrages über 150 Airbus-Flugzeuge, der schon am 1. Dezember offiziell, aber noch nicht öffentlich bekannt, verbucht worden war.
Mit 378 Flugzeugen habe Airbus 2005 zum dritten Mal in Folge mehr Jets als Boeing ausgeliefert, wo 290 Flugzeuge an die Kunden übergeben wurden. Sogar fünf Jahre in Folge habe man mehr Neubestellungen erzielt, so Airbus. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden hat Airbus die Gewinnmarge auf „etwas über zehn Prozent“ erhöht und werde sie weiter steigern. Airbus habe trotz eines weiterhin sehr niedrigen Dollarkurses das Kostensenkungsprogramm Route 06 erfolgreich umgesetzt und 1,5 Milliarden Euro gespart.
Den größten Erfolg für Airbus errang die Standardrumpffamilie A320, die alleine 918 Bruttoaufträge an Land ziehen konnte. Sie deklassierte die mit 574 Bestellungen (inklusive BBJ) keineswegs erfolglose 737NG, obwohl sich diese nach Preissenkungen wieder deutlich besser verkaufte. Genau umgekehrt sieht die Lage im Großraumbereich aus, hier liegt Boeing in Führung: 19 Exemplare der Boeing 767, 155 Boeing 777 und 235 Boeing 787 konnten die Amerikaner verkaufen. Airbus kommt dagegen auf 7 A300-600R, 64 A330, 15 A340 und 87 A350. Dabei beunruhigt insbesondere der momentan geringe Verkaufserfolg der vierstrahligen A340-500 (0) und A340-600 (12) gegenüber den neuesten, sehr leistungsfähigen, aber auch teuren 777-Versionen. Dazu gehörten 98 Exemplare der 777-300ER, 31 Bestellungen für die 777-200LR und 23 für die neue Frachtversion 777F.
Schließlich fehlen im oberen Marktsegment noch die A380 und die 747. Boeing konnte 30 klassische Jumbo-Frachter der Versionen 747-400F und 747-400ERF verkaufen und erzielte für die neu angekündigte 747-8F weitere 18 Bestellungen. Dagegen gingen Passagierversionen der 747-400 und 747-8 im vergangenen Jahr leer aus. Für letztere Version wurde bisher noch kein einziger Auftrag bekannt. Die A380 errang 2005 je zehn Bestellungen als Passagier- und Frachtvariante. Airbus-Co-COO John Leahy erwartet die nächste A380-Bestellungswelle branchentypisch nach dem Dienstbeginn des Riesen, also Ende 2006/ Anfang 2007. Noch für 2006 stellte er immerhin zwei neue Kunden in Aussicht.
Trotz der momentanen Jubelstimmung gibt es sowohl bei Airbus als auch bei Boeing Sorgenkinder: So läuft die 737, gerade wird eine überarbeitete Kurzstartvariante der 737-800 flugerprobt, eindeutig nicht so gut wie die europäische A320. Für Boeing scheint deshalb die Entscheidung über einen Nachfolger eher als für Airbus ins Haus zu stehen. Sofern man die benötigten Triebwerke einer neuen Generation zur Verfügung hat, dürfte der Einsatz eines auf der 787-Technologie basierenden, völlig neuen 737-Nachfolgers schon ab 2013 wahrscheinlich werden. Bei Airbus schiebt man das Thema A320-Nachfolger noch etwas weiter in die Zukunft. Wohl auch, um die gut laufenden A320-Verkäufe nicht zu stören. Gustav Humbert: „Wenn der Markt völlig neue Standardrumpfflugzeuge will, wird Airbus reagieren. Aber wir bauen keine Segelflugzeuge und brauchen deshalb ein neues Triebwerk.“ Nach Humberts Worten sprächen die Aussagen der Triebwerkshersteller für einen Einsatzbeginn nicht vor 2013 bis 2014.“ [FLUG REVUE 3/2006]
Das andere Frankfurt

Mit Hilfe von Fraport und Ryanair hat sich der Flughafen Frankfurt-Hahn vom verlassenen Fliegerhorst zum Drehkreuz im boomenden Billigflugsektor gemausert. „Das Wichtigste war 2006 unser erstes positives Betriebsergebnis mit 500000 Euro Gewinn“, blickt Jörg Schumacher, Sprecher der Geschäftsführung des Flughafens Frankfurt Hahn, beim Gespräch mit der FLUG REVUE erleichtert zurück. „Es kam darauf an, zu zeigen, dass wir es schaffen, durch Wachstum in die schwarzen Zahlen zu kommen und dass unser Geschäftsmodell funktioniert.“ Zwischen 2002 und 2006 hat der Flughafen seine Umsätze verdreifacht. Schumacher verspricht für 2009 auch das erste positive Gesamt-Jahresergebnis.
Das Konzept des 120 Kilometer westlich von Frankfurt liegenden Flughafens weicht stark von dem seiner meisten deutschen Konkurrenten ab. Hahn, im Kalten Krieg als Atombomberbasis der US-Luftwaffe auf den einsamen Höhenzügen des Hunsrück errichtet, ist weder Megadrehkreuz noch Großstadtairport, sondern ein Stück schnörkellose, funktionale Infrastruktur. Die Nüchternheit der Zweckbauten, an vielen Stellen blickt man im Terminal auf nacktes Blech und unverkleidete Decken, erinnert eher an Baumärkte oder an die Filialen eines „unmöglichen“ Möbelhauses aus Schweden. Was es nicht gibt, sind Fluggastbrücken. In Hahn laufen die Passagiere durch abgezäunte Gassen direkt über das Vorfeld zu den wartenden Flugzeugen. „An anderen Flughäfen laufen Sie auch, aber bevor Sie ans Gate kommen“, kontert Flughafenchef Schumacher.
3,7 Millionen Passagiere, größtenteils Ryanair-Gäste, nutzten den Flughafen 2006, 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 38 Prozent der abfliegenden Gäste stammen aus dem Rhein-Main-Gebiet, und aus Rheinland-Pfalz stammen sogar 43 Prozent. Das mit Abstand wichtigste Abflugziel ist London vor Rom. 20 Prozent aller Fluggäste in Hahn sind Geschäftsreisende. 32 Prozent der ankommenden Geschäftsreisenden haben die Stadt Frankfurt am Main als Ziel, weitere jeweils 20 Prozent Mainz und Wiesbaden. Durchschnittlich 50 Cent gibt jeder Passagier im Terminal aus, ohne Parkgebühren gerechnet.
Für 2007 erwartet der Flughafen schon 4,3 Millionen Fluggäste, und bis 2012 soll dieser Wert stufenweise auf imposante 9,7 Millionen steigen. Es wird also Zeit, an den Ausbau zu denken. Seit 1998 haben die drei Eigentümer der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, die Fraport AG (65 Prozent) und die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen (je 17,5 Prozent), 135 Millionen Euro in den Ausbau investiert. Weitere 240 Millionen Euro sollen bis 2010 verbaut werden. Hahn rüstet auf. Als nächstes soll die bereits für 37 Millionen Euro von 3045 Meter auf 3800 Meter verlängerte Startbahn 03/21 in voller Länge in Betrieb gehen. Diese wird besonders von schweren Frachtern benötigt, die auf dem mit 500 Metern ungewöhnlich hoch gelegenen Platz besonders bei sommerlicher Wärme für jeden Meter Pistenlänge dankbar sind. Aeroflot Cargo wird dadurch ihre Dienste von der heutigen DC-10F auf die schon lange gewünschte, schwerere MD-11F umstellen können.
Noch im Frühjahr beginnt der Umbau der alten Ankunftshalle zu Abfluggates und der Bau einer neuen Ankunftshalle, damit in den Spitzenzeiten drei bis vier zusätzliche Flüge, insgesamt 14 bis 15 parallel, abgefertigt werden können. „Wir bauen eine Schuhschachtel nach der anderen“, freut sich Flughafenchef Schumacher. Die reibungslose Abfertigung ist insbesondere für den Schlüsselkunden Ryanair entscheidend, der seine Jets schon 25 Minuten nach dem Abstellen der Triebwerke mit neuen Gästen und deren Gepäck in der Luft haben möchte. Im Mai beginnt auch der Bau einer neuen Frachthalle mit 6000 Quadratmeter Grundfläche. Und schließlich werden 2007 vier neue Vorfeldpositionen am Terminal und zwei weitere Frachtpositionen für Großraumjets geschaffen. Außerdem wird die zum Flughafen führende Bundesstraße 50 weiter vierspurig ausgebaut. Auf lange Sicht plant der Flughafen neben dem Neubau einer doppelten Parallelrollbahn die Verlagerung des Passagierbetriebs in ein völlig neues Terminal südwestlich der heutigen Anlagen, für das man - nicht vor 2010 - sogar auf einen Eisenbahn-Wiederanschluss nach Mainz durch die Deutsche Bahn AG hofft. [FLUG REVUE 6/2007]
Bereit zum Sprung?

Das erfolgreichste Verkehrsflugzeugtriebwerk aller Zeiten hat einen weiteren Rekord erzielt: Im vergangenen Oktober lieferten GE und Snecma das 20000. CFM56 aus. Dabei gab es stellvertretend für die beiden aktuellen Anwendungen zwei Jubiläumsantriebe, denn einer ging an einen Airbus A321 der Air France, der andere an eine Boeing 737-800 von flydubai. Damit hat das US-französische Gemeinschaftsprodukt den Abstand zum ehemals meistgebauten Triebwerk, dem Pratt & Whitney JT8D (11845 Exemplare bis 1982) fast verdoppelt, und ein Ende scheint nicht in Sicht, auch wenn der Markt weiter von der Wirtschaftskrise betroffen ist. „Vergleicht man 2009 mit den letzten drei, vier Jahren, ist es enorm ruhig. Es gab nur ein Drittel der Aufträge“, sagt Chaker Chahrour, Executive Vice-President von CFM, beim Besuch der FLUG REVUE in Cincinatti.
„In unter zehn Jahren können wir das 30000. CFM56 erreichen.“ Angesichts des aktuellen Auftragsbestands von rund 5200 Aggregaten ist die halbe Strecke schon fast zurückgelegt. Wäre denn auch die Zahl 40000 möglich? Da muss Chahrour grübeln: „Es wird schwierig, aber wenn das CFM56 noch zehn Jahre in Produktion bleibt, wäre es vielleicht möglich.“ Das hängt natürlich vom noch offenen Einführungstermin der nächsten Generation ab. Momentan laufen die Entwicklungsarbeiten für das LEAP-X auf Hochtouren.
Die am 12. Juni 2009 begonnenen erste Testphase eines Kerntriebwerks, genannt eCore 1, konnte nach rund 35 Stunden bereits abgeschlossen werden. Sie konzentrierte sich vor allem auf die Brennkammer und die Hochdruckturbine. „Die Ergebnisse sehen blendend aus“, meint LEAP-Programm-Manager Ron Klapproth. Der zweite Versuchsabschnitt steht im ersten Quartal 2010 an und konzentriert sich auf den Verdichter.
Um das ehrgeizige Verbrauchsziel zu erreichen, nämlich 16 Prozent weniger als das beste CFM56, braucht es ein erheblich höheres Druckverhältnis. Gleichzeitig soll die Stufenzahl mittels fortschrittlicher Aerodynamik sinken. Der Hochdruckverdichter des CFM56 besitzt neun Stufen, der von eCore 1 nur acht. „Aber wir steigern das Druckverhältnis von rund 11:1 auf ungefähr 16:1, also eine 50-prozentige Erhöhung”, erklärt Klapproth.
LEAP-X könnte ab 2015 in Dienst gehen. „Wir haben das Programm auf mehrere mögliche Daten ausgerichtet. Wir konzentrieren uns dabei auf die Bereitstellung von Technologien. Abhängig vom Indienststellungsdatum kommen einige ins Produkt, andere schaffen es noch nicht.“ Ein wesentlicher Bestandteil steht jedoch schon fest: der Bläser mit Schaufeln und Gehäuse aus Verbundwerkstoffen. Im MASCOT-Programm (Moteur à Aubes de Soufflante en Composite Taille) hat Snecma Anfang 2009 in Villaroche einen entsprechenden Fan an einem CFM56-5C getestet. Anschließend erfolgten Seitenwindversuche und Lärmmessungen auf dem GE-Freiluftprüfstand in Peebles. [FLUG REVUE 1/2010]
Der graue Riese fliegt

Großer Tag für Airbus Military: Mit 23 Monaten Verspätung hob am 11. Dezember 2009 in Sevilla die A400M zum erfolgreichen Jungfernflug ab. Das Feilschen darum, ob die europäischen Kunden einen Teil der erheblichen Mehrkosten des Programms übernehmen, geht derweil auch im neuen Jahr weiter.
Während in Teilen Deutschlands der Winter Einzug hielt, hätten die Prognosen für das südspanische Sevilla am 11. Dezember nicht besser sein können: Temperaturen bis 20 Grad bei wolkenlosem Himmel und am Morgen Nordostwind mit 9 km/h. Der perfekte Tag für einen extrem wichtigen Erstflug, auf den vor allem die bedeutendsten Kunden des Militärtransporters A400M mit wachsender Ungeduld gewartet hatten.
Für die sechsköpfige Besatzung und das gesamte Flugtestteam von Airbus Military begann der Tag bereits weit vor Morgengrauen. Als die Sonne gegen 8.30 Uhr über Andalusien aufging, saßen Edward „Ed“ Strongman, Airbus-Cheftestpilot für Militärprogramme, sein Kollege Ignacio „Nacho“ Lombo sowie die Flugtestingenieure Jean-Philippe Cottet (Triebwerke), Eric Isorce (Systeme und Leistung), Didier Ronceray (Handling) und Gerard Leskerpit bereits in der A400M mit der Kennung F-WWMT, um mit den umfangreichen Vorflugchecks der Flugzeugsysteme und der nicht weniger als 13 Tonnen schweren Testinstrumentierung zu beginnen.
Vier harte Wochen lagen hinter ihnen und der ganzen Testmannschaft, die die MSN1 am 12. November aus der Fertigung übernommen hatte. In drei Schichten rund um die Uhr wurde der erste Prototyp durchgecheckt. „Einmal hatten wir über Nacht ein neues Software-Update für die Triebwerke“, erinnerte sich Strongman beim Gespräch mit der FLUG REVUE nach dem Erstflug.
Während die Gäste nach und nach eintrafen, wich der Schatten der riesigen neuen A400M-Endmontagehalle im Werk San Pablo von dem ganz in Hellgrau gestrichenen Militärtransporter, der von der Testcrew den Spitznamen „Grizzly“ erhalten hat. Pünktlich um neun Uhr wurde das erste TP400-D6-Triebwerk angelassen. In etwa einer Minute erreichte der mit nominal 8200 Kilowatt (11000 shp) stärkste je in Westeuropa entwickelte Turboprop seine stabile Leerlaufdrehzahl, und die acht sichelförmigen Propellerblätter von Ratier-Figeac verschmolzen zu einer surrenden Scheibe.
Um 9.11 Uhr liefen alle vier Aggregate, wobei die Drehrichtung der Propeller auf jeder Flügelseite gegenläufig ist, um im Fall eines Triebwerksausfalls die Drehmomentkräfte zu begrenzen. Nach weiteren Checks setzte sich die MSN1 um 9.40 Uhr langsam in Bewegung, gefolgt von einer Corvette der Aéroformation, die bei Airbus oft als Begleitflugzeug dient. Vorbei am zivilen Terminal auf der Nordseite des Flughafens von Sevilla, erreichte die A400M das Ende der Bahn 09. Ganz problemlos ging es dann aber doch nicht in die Luft. Wie Airbus später erläuterte, mussten Computer der Flugtestinstrumentierung zwei Mal neu gestartet werden, bevor sie einwandfrei liefen. Man hätte auch ohne sie fliegen können, wollte aber auf wichtige Versuchsmöglichkeiten nicht verzichten.
Nachdem die Corvette um 10.12 Uhr abgehoben hatte, setzte sich die 127 Tonnen schwere A400M schließlich drei Minuten später in Bewegung, beschleunigte recht schnell und stieg mit erstaunlich geringer Lärmentwicklung in einem flachen Winkel gen Osten in den strahlend blauen Himmel. Am Boden war die Erleichterung der Verantwortlichen spürbar: Domingo Urena-Raso, seit Februar 2009 Chef von Airbus Military, Airbus-Boss Tom Enders und EADS-Vorstandsvorsitzender Luis Gallois lagen sich am Rande der Runway in den Armen. [FLUG REVUE 2/2010]
Russlands neuer Superfighter

Das neue Jahrzehnt begann mit einem Paukenschlag: Am 29. Januar hob bei der KnAAPO in Komsomolsk am Amur der bislang streng geheime, künftige russische Top-Fighter zu seinem Jungfernflug ab.
„Normalna“ seien der Flug und die Landung gewesen, so der coole erste Kommentar von Suchoi-Testpilot Sergei Bogdan, nachdem ihn die Bodenmannschaft hatte hochleben lassen. „Die Maschine reagiert sehr angenehm und ist einfach zu fliegen. Sie verhielt sich bei allen Testpunkten hervorragend. Wir haben auch das Fahrwerk eingefahren,“ so Bogdan weiter.
Die Freude auf dem Werksflugplatz der KnAAPO (Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association) im bitterkalten, aber strahlend sonnigen Komsomolsk am Amur war also groß, denn schließlich galt es den erfolgreichen Erstflug des neuen russischen Top-Fighters der sogenannten fünften Generation zu feiern.
Kein einziges Foto der T-50 war bis zum 29. Januar nach draußen gedrungen, und offizielle technische Daten gibt es von Suchoi natürlich auch nicht. So dürfen die westlichen Experten nun fleißig spekulieren, welche Leistungen von dem im Rahmen des PAK-FA-Programms (Perspektivnij Aviatsionnij Komplex Fronotvoi Aviatsij = Zukünftiges Flugzeugsystem der Frontfliegerkräfte) entwickelten Mehrzweck-Kampfflugzeug zu erwarten sind, das die Nachfolge der weit verzweigten „Flanker“-Familie (Su-27, Su-30, Su-33, Su-35) antreten soll.
Gut ein Jahrzehnt hat es gedauert, bis Suchoi die T-50 in die Luft gebracht hat. Die ersten Anforderungen der russischen Luftstreitkräfte stammen wohl aus dem Jahr 1998. Erst 2002 wurde aber angeblich eine vergleichende Bewertung der Entwürfe von Suchoi und Mikojan vorgenommen. Die offizielle Auswahl durch eine Regierungskommission fand am 26. April 2002 statt. Nach einer Vorentwurfsphase wurde das T-50-Programm Ende 2004 gestartet, bei dem Alexander Davidenko als Chefkonstrukteur fungierte.
Die Finanzierung wird hauptsächlich durch das Industrie- und Energieministerium sichergestellt. Auch Suchoi und seine „mehr als hundert“ Zulieferer tragen einen Teil bei, so dass der Anteil des Verteidigungsministeriums für einige Jahre bei nur 20 Prozent lag. Die Tatsache, dass die Gelder regelmäßig flossen, dürfte entscheidend dafür gewesen sein, dass die Entwicklung für russische Verhältnisse schnelle und termingerechte Fortschritte machte.
Ministerpräsident Wladimir Putin sagte nach dem Erstflug, die T-50 könnte ab 2015 in die Serienfertigung gehen – ein Ziel, das viel zu ambitioniert erscheint, wenn man andere aktuelle Kampfflugzeug-Entwicklungsprogramme betrachtet. Der Bedarf der Luftstreitkräfte soll bei 250 Flugzeugen liegen.
Damit will sich Suchoi aber keineswegs zufriedengeben. „Wir übertreffen unsere westlichen Rivalen in der Kosteneffizienz und können daher einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt gewinnen“, gab sich Michail Pogosjan, Chef der staatlichen Suchoi-Holding, nach dem Erstflug überzeugt. [FLUG REVUE 3/2010]
Die letzte Mission

Nach 30 Jahren und 135 Starts ist die Ära der US-Raumfähren beendet. Die NASA wird nun ohne ihr leistungsstarkes und vielseitiges Space Transportation System auskommen müssen. Seine letzte Mission führte das Space Shuttle einmal mehr zur Internationalen Raumstation, die für Astronauten vorerst nur noch per Sojus-TMA-Kapsel erreichbar ist.
Kennedy Space Center, 21. Juli, 5.57 Uhr: Noch vor Sonnenaufgang schwebt der Orbiter OV-104 „Atlantis“ von Nordwesten auf die viereinhalb Kilometer lange Bahn der „Shuttle Landing Facility“ ein und setzt punktgenau auf. Es ist die 25. Nachtlandung eines Space Shuttle. „Mission complete, Houston“, funkt Commander Chris Ferguson an das Kontrollzentrum, bevor er nach einigen routinemäßigen Checks zusammen mit Pilot Doug Hurley sowie den Missionsspezialisten Sandra Magnus und Rex Walheim den Raumgleiter verlässt – die nun wirklich letzte Mission eines Space Shuttle ist zu Ende.
Den letzten Start eines Shuttle am Cape hatten Hunderttausende von Schaulustigen am 8. Juli verfolgt. Trotz Regen am Tag zuvor und ungünstiger Wetterprognosen hob die Atlantis um 11.29 Uhr Ortszeit fast pünktlich ab. Nur bei T-31 Sekunden musste der Countdown für einige Minuten unplanmäßig unterbrochen werden, um den Status der Sauerstoffabsaugkappe an der Startrampe zu verifizieren. Bei tropischen 33 Grad Celsius war das Shuttle nach einer halben Minute in der tief hängenden Wolkendecke verschwunden.
Es hatte die NASA einige Mühe gekostet, im US-Kongress die Gelder für die Mission STS-135 lockerzumachen, denn immerhin schlug ein Shuttle-Flug zuletzt mit etwa 775 Millionen Dollar (540 Mio. Euro) zu Buche. Eine Investition, die sich aus Sicht der US-Raumfahrtbehörde aber auszahlen wird, denn es ging darum, noch einmal eine große Menge von Versorgungsgütern zur International Space Station (ISS) zu bringen.
Das in Italien gebaute Mehrzweck-Logistikmodul Raffaello in der Ladebucht des Orbiters war vollgestopft mit 4265 Kilogramm Material, darunter allein 1215 Kilogramm Nahrungsmittel für die mittlerweile sechsköpfige Dauerbesatzung der ISS. Dazu kamen 1045 Kilogramm im Mitteldeck der „Atlantis“.
Letzte Aufgabe der Atlantis nach dem Abkoppeln von der Station am 20. Juli war das Aussetzen des 3,7 Kilogramm schweren Kleinstsatelliten PSSC-2 (Picosat Solar Cell) – die 180. von Shuttles im All platzierte Nutzlast. Danach folgte der nicht ungefährliche Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, der einst „Columbia“ zum Verhängnis geworden war.
Diesmal ging alles glatt, und die NASA konnte der beeindruckenden Bilanz ihres Space Transportation System weitere 12 Tage, 18 Stunden und 29 Minuten hinzufügen. Bis zur Mission STS-134 von OV-105 „Endeavour“ im Mai hatte sich die Zeit im All auf 1320 Tage, eine Stunde und 32 Minuten summiert. Die fünf Orbiter hatten dabei 20952 Erdumrundungen absolviert und 864 Millionen Kilometer zurückgelegt, was der Distanz von der Erde zum Jupiter entspricht. [FLUG REVUE 9/2011]
Die „neue“ Germanwings

„Der Luftverkehrsmarkt ändert sich schnell und sogar noch schneller, als vor wenigen Wochen gedacht“, sagte Lufthansa-Konzernchef Christoph Franz über den Entscheidungsdruck bei der Vorstellung der „neuen“ Germanwings am 6. Dezember in Köln. Es sei ein erheblicher Marktdruck durch die Niedrigpreis-Airlines entstanden. Man wolle sich lieber aus einer Position der Stärke heraus anpassen und unter einem Dach in die Offensive gehen, als von der veränderten Marktlage getrieben werden.
„Unsere direkten Europaverkehre sind seit Jahren defizitär. Der Handlungsbedarf ist evident“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Nach Lufthansa-Angaben liegen die jährlichen Verluste hier im dreistelligen Millionen-Bereich (Euro). „Unsere erste Option war deshalb der Rückzug aus der Fläche und die alleinige Bedienung der Drehscheiben. Das haben viele Wettbewerber so gemacht.“ So sei British Airways quasi zur „Heathrow Airways“ geworden, sagte Franz. Die zweite Option sei die Beibehaltung des Angebotes in der Fläche gewesen, aber dies zu deutlich günstigeren Kosten. Für diese Variante habe man sich entschieden. „Wir wollen ein dichtes Streckennetz anbieten können.“
Ab dem Sommer 2013 soll deshalb die „neue Germanwings“ zu 20 Prozent niedrigeren Stückkosten den gesamten dezentralen Europaverkehr von Lufthansa übernehmen, also alle Direktflüge, die nicht die Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München berühren. Damit erhält die bisherige Niedrigpreis-Fluggesellschaft eine tragende Rolle bei der klassischen Linie und muss entsprechend umgebaut werden. Neue Routen, neuer Markenauftritt und neue Kabinen. Aber im Mittelpunkt steht ein neues, dreiteiliges Preiskonzept, mit dem die, laut ihrem Chef, „All Economy Airline“ Germanwings die unterschiedlichen Kundengruppen mit einem maßgeschneiderten Angebot gezielt erreichen soll.
Schon zum Jahresbeginn 2013 nimmt das weiterhin in Köln beheimatete Management seine Arbeit für die neue Germanwings auf und führt die Organisationen von Lufthansa und Germanwings zusammen. Ab Juli fliegen dann die ersten Flugzeuge nach dem neuen Tarifkonzept. Ab 2015 soll der Bereich schwarze Zahlen schreiben. Keine leichte Aufgabe, denn auch die bisherige Germanwings machte, trotz ständiger Rationalisierungsprogramme, keine Gewinne. Als Kalkulationsgrundlage gilt ein Kerosinpreis von 100 Dollar pro Fass.
Die neue Germanwings soll am 17-Milliarden-Euro-Umsatz der Lufthansa Passage Airline einen Anteil von zehn Prozent erreichen, 20 Prozent von deren Passagieren befördern und gut 30 Prozent der Europaflotte betreiben. Sie wird mit einer Flotte aus 52 Flugzeugen antreten, darunter 29 Airbusse der A320-Familie und 23 Bombardier CRJ900-Regionalflugzeuge, die von Eurowings für nachfrageschwächere Strecken geleast werden. Nach einer zweijährigen Übergangszeit soll die Flotte aus 90 Flugzeugen bestehen und die Airline mit dann 2500 Mitarbeitern 20 Millionen Passagiere im Jahr befördern und 110 Ziele bedienen. [FLUG REVUE 2/2013]